
Bildung und individuelle Hilfen verhindern Jugendarmut
„Die Politik ist gefordert, entschieden die Armut von Kindern und Jugendlichen zu bekämpfen. Benachteiligte Kinder und Jugendliche frühzeitig zu fördern, ist daher dringend notwendig“, fordert

„Die Politik ist gefordert, entschieden die Armut von Kindern und Jugendlichen zu bekämpfen. Benachteiligte Kinder und Jugendliche frühzeitig zu fördern, ist daher dringend notwendig“, fordert

Obwohl in Deutschland immer weniger Kinder und Jugendliche leben, an der Tatsache, dass ihre derzeitige und zukünftige Lebenssituation immer noch entscheidend durch ihre soziale Herkunft

Der aktuelle Bildungsbericht der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) belegt wieder, dass der Schulerfolg eines Kindes in Deutschland weiterhin stärker vom sozioökonomischen Hintergrund

Das Sozialgericht (SG) Stade verurteilt ein Jobcenter zur Übernahme von Anschaffungskosten für einen Laptop in Höhe von 399,- €. Das machte der Arbeits- und Sozialrechtler

Der Aufstieg durch Bildung sollte jedem möglich sein. Deutschland sollte „Bildungsrepublik“ werden. Das waren die Versprechen des Bildungsgipfels vom 22. Oktober 2008. Doch es bleibt

Expertinnen und Experten fordern breiten gesellschaftlichen Diskurs zu Bildungsgerechtigkeit: Der von der Bundesregierung geplante Nationale Bildungsrat muss für eine grundsätzliche Verständigung zu Aufgaben und Zielen des

Für einen „bildungspolitischen Aufbruch“ setzt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ein. Deutschland bleibe immer noch deutlich hinter den Anforderungen an ein modernes, chancengerechtes und

Generell sehen die Lehrerinnen und Lehrer einen dringenden Modernisierungs- und Sanierungsbedarf an den Schulen. Das geht aus einer repräsentativen Mitgliederbefragung der Bildungsgewerkschaft GEW hervor. Ihren
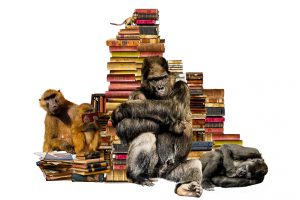
Der berufliche und soziale Status der Eltern bleibt der wichtigste Faktor, der die Teilnahme an Bildung sowie wirtschaftlichen und sozialen Erfolg beeinflusst. Dies geht aus

Ein internettauglicher PC/Laptop, nebst notwendigem Zubehör und Serviceleistungen in Höhe von 600 EUR ist vom Jobcenter auf Zuschussbasis zu übernehmen. So lautet ein Gerichtsurteil des