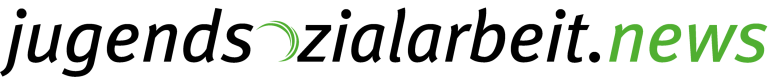Demokratiebildung ist das zentrale Thema des 16. Kinder- und Jugendberichts. Neben den Feldern Familie, Kita und Schule ist auch die Jugendsozialarbeit im Blick. Die “Jugendsozialarbeit News” richten in den nächsten Wochen den Blick auf die Rolle, Beiträge und Handlungserfordernisse der Jugendsozialarbeit in Bezug auf demokratische Bildung. Wir fragen Expert*innen und Praktiker*innen “WARUM DEMOKRATIEBILDUNG IM JUGENDALTER UNVERZICHTBAR IST…” und bringen damit Standpunkte und Perspektiven der Jugendsozialarbeit in die Fachdebatte ein.
Dieses Mal beantworten die Referentinnen Christine Müller, Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit (BAG KJS) und Ann-Kristin Beinlich, Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in Deutschland (AKSB) unsere Fragen. Sie arbeiten im Bundesprogramm „Respekt Coaches“ zusammen.
Frau Beinlich, Frau Müller, warum ist aus Ihrer Perspektive Demokratiebildung im Jugendalter unverzichtbar?
Ann-Kristin Beinlich: Aufgrund der Pandemie befinden wir uns ja gerade in einer gesellschaftlichen und politischen Ausnahmesituation. Wegen der Maßnahmen gibt es immer mehr Menschen, die sich in ihrer Freiheit eigeschränkt fühlen und von der Politik enttäuscht sind. Jugendliche sind eine Gruppe, die lange Zeit nicht beachtet wurden. Sie sind oftmals frustriert. In so einer Situation ist es wichtig, dass wir aufzeigen, was Politik und auch Demokratie bedeuten und welche Werte einer Demokratie zugrunde liegen. Was hat das mit der Lebenswelt der Jugendlichen zu tun? So können Jugendliche sich mit einer demokratischen Haltung auseinandersetzen, sie einüben und für sich einnehmen. Das ist eine wichtige Aufgabe, die Jugendsozialarbeit und Politische Bildung haben: Menschen darin zu unterstützen, mündige Bürger*innen zu werden. Räume für Partizipation und Selbstwirksamkeitserfahrungen sind dabei ganz entscheidend.
Christine Müller: Genau! Demokratie muss immer wieder neu gelernt, vorgelebt und damit auch erfahren werden. In einer lebendigen Demokratie brauchen wir mündige Bürger*innen, die sich aktiv, kritisch und selbst-reflexiv für ihre Interessen engagieren. Durch Demokratiebildung erkennen Jugendliche, wie Gesellschaft funktioniert, wo ihre Rechte und Chancen liegen, aber auch wo sie selbst Verantwortung haben. In der Pandemie ist nicht nur der Freiheitsbegriff sehr wichtig, sondern auch der Begriff der Solidarität, etwa um sich für Schwächere einzusetzen.
Sie arbeiten im Kontext des Bundesprogramms „Respekt Coaches“ eng zusammen. Was sind jeweils Ihre Aufgaben?
Christine Müller: Ich bin im Bundesprogramm für die Koordination der Respekt Coaches in katholischer Trägerschaft zuständig – zusammen mit meiner Kollegin Vanessa Prack. Wir bearbeiten die Anträge der Respekt Coaches für die Maßnahmen. Meine Aufgabe ist auch die Kooperation mit anderen Diensten und Trägergruppen. Ann-Kristin und ich identifizieren Synergien unserer Organisationen.
Ann-Kristin Beinlich: Ich bin Projektkoordination für das Projekt „Religionssensible politische Bildungsarbeit“ der AKSB, was Teil des Bundesvorhabens der Respekt Coaches ist. Meine Aufgabe ist es, die sechs Netzwerkstellen, die wir deutschlandweit haben, zu koordinieren. Diese arbeiten mit den Respekt Coaches auf lokaler oder regionaler Ebene zusammen.
Christine und ich arbeiten daran, wie wir die Perspektiven der beiden Disziplinen Jugendsozialarbeit und Politische Bildung zusammenbringen.
Der gemeinsame Sammelband „Politische Bildung und Jugendsozialarbeit gemeinsam für Demokratie“ der BAG KJS und der AKSB ist kürzlich erschienen. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Botschaften der Publikation, Frau Beinlich?
Ann-Kristin Beinlich: Die zentrale Aussage ist: Politische Bildung und Jugendsozialarbeit sind dann besonders wirksam, wenn sie synergetisch zusammenarbeiten. Die Jugendsozialarbeit hat grundsätzlich einen leichteren Zugang zur Zielgruppe der Jugendlichen. Sie hat die Expertise, auf die Jugendlichen zuzugehen, aber auch eine Bindungsarbeit aufzubauen und zu intensivieren. Die Politische Bildung macht Angebote für alle Altersgruppen.
Meine Erfahrung zeigt, dass regelmäßig stattfindende Maßnahmen besonders wirksam sind. Die Jugendlichen öffnen sich mehr und können eine Vertrauensebene entwickeln. Ein weiteres Ergebnis ist, dass wir Religion als Ressource im Bildungsprozess verstehen. Wir bringen eine offene Haltung mit, wenn Religion Thema wird.
Eine unserer zentralen Forderungen ist, die Lebenswelt Schule in den Blick zu nehmen und Angebote z.B. auch für Lehrer*innen vorzuhalten.
Der 16. Kinder- und Jugendbericht empfiehlt: die Jugendsozialarbeit und politische Bildung sollten sich stärker annähern, sowohl in den Fachdebatten als auch in der Praxis. Frau Müller, warum ist das bisher nicht der Fall oder warum sind die bestehenden Kooperationen nicht sichtbar genug?
Christine Müller: Es sind in der Praxis immer noch überschaubare Beispiele. Die Praxis ist teils eng in ihren eigenen Kontexten verstrickt. Das gilt für beide Seiten – Politische Bildung und Jugendsozialarbeit. Bei der Jugendsozialarbeit würde ich sagen, dass das Thema Übergang Schule – Beruf sehr stark im Fokus steht. Selbstkritisch muss die Jugendsozialarbeit reflektieren, wo sie Maßnahme-orientiert agiert und nicht so lebensweltorientiert, wie sie eigentlich sollte. Bei der Politischen Bildung denke ich: sie hat immer noch einen etwas theorielastigen und wenig lebensweltorientierten Zugang zu jungen Menschen, die noch nicht so lange in Deutschland leben oder die von Diskriminierung betroffen sind u.a. aufgrund ihrer ethnisch/nationalen Herkunft, aufgrund sozial prekärer Lebensrealitäten, gesundheitlicher oder bildungsbezogener Einschränkungen. Die Respekt Coaches könnten eine gute Schnittstelle sein durch die Andockung an Schulen. Ich bin aber auch ein Fan von außerschulischer politischer Bildung. Das ist ein Punkt, den wir im Programm noch stärker berücksichtigen könnten: Sozialraumorientierung, andere Lernorte finden. Wie könnte man gute Beispiele flächendeckender aufstellen? Das wollen wir in der Praxis weiterbearbeiten. Wir brauchen aber auch Lobbyarbeit, um dies stärker in die Maßgabe der Programmverantwortlichen bzw. Geldgeber zu bringen. In Angeboten der Jugendsozialarbeit sollten Angebote der Demokratiebildung nicht ein Plus sein, sondern Teil der Regelarbeit werden. Partizipation muss gelebt werden!
Politische Bildung und Demokratiebildung werden im Kinder- und Jugendbericht als synonyme Begriffe verwendet. Sehen Sie das genauso, Frau Beinlich?
Ann-Kristin Beinlich: Die Begriffe werden leider öfter synonym verwendet. Aus meiner Sicht ist Politische Bildung immer Teil von Demokratiebildung. Demokratiebildung sehe ich eher als Sammelbegriff für unterschiedliche Bildungskonzepte. Wenn beispielsweise eine Jugendgruppe eine gemeinsame Aktivität abstimmt, ist das durchaus ein Erlernen von Demokratie, ein Einüben von demokratischen Prozessen, womit auch einher geht, dass ich eine gewisse Frustrationstoleranz mitbringen muss. „Politische Bildung“ würde diesen Prozess dann beschreiben, reflektieren und auf eine nächste Ebene bringen. Auch wenn das theoretisch klingt: es kann sehr erfahrbar gestaltet sein! Hier könnten die Politische Bildung und die Jugendsozialarbeit einen gemeinsamen Verständnishorizont erarbeiten.
Der Kinder- und Jugendbericht kritisiert, dass politische Bildung in der Jugendsozialarbeit oft nur anlassbezogen und mit engen Zielgruppenkonzeptionen umgesetzt würde. Frau Müller, was können Sie dem entgegnen?
Christine Müller: Jugendsozialarbeit muss oft über Maßnahmen mit engen Zielgruppenbeschreibungen agieren, in denen es wenig Raum gibt, Politische Bildung mehr als lediglich anlassbezogenen umzusetzen. Es gibt hier aber auch Angebote, die nicht als Politische Bildung identifiziert und kommuniziert werden, allerdings Elemente dieser aufgreifen. Hier bietet sich ein Diskurs zwischen Politischer Bildung und Jugendsozialarbeit an. Gefragt werden könnte, wie theoretisch muss etwas sein, damit es sich Politische Bildung nennen darf? Muss es einen bestimmten kognitiven Anspruch erfüllen? In einem Projekt habe ich erlebt, wie junge Menschen sich intensiv und kreativ mit ihrer Lebenswelt auseinandergesetzt haben. Ergebnis war ein selbst produzierter Rap. Die Selbstzuschreibung der Teilnehmenden zeigte dabei, dass die Erfahrung von Zuschreibungen, Kategorisierungen ihrer „Förderbedarfe“ und damit auch Diskriminierungen schon so stark Teil der eigenen Identität geworden ist, dass sie diese als prägendes Merkmal in einer Vorstellungsrunde erwähnen. Zur Aufarbeitung dieser Erfahrungen müssen Einrichtungen der Jugendsozialarbeit sich noch stärker damit auseinandersetzen, ob das was sie tun, immer förderlich ist. Etwa in der Jugendberufshilfe könnten wir in der BAG KJS auch mit der Bundesagentur für Arbeit in einen Diskurs gehen. Wie können Jugendliche in berufsbezogenen Maßnahmen tatsächlich Partizipation und Selbstwirksamkeit erfahren? Auch Fachkräfte haben teils einen größeren Reflexionsbedarf in puncto Politische Bildung und Demokratiebildung. Wichtig ist die Haltung: Wir können einen Teil dazu beitragen, Jugendliche zu unterstützen mündig zu werden. Das ist eine Aufgabe der Jugendsozialarbeit. Hier bringt die Kooperation mit der Politischen Bildung einen Mehrwert, etwa in Form von Fortbildungen und Fachaustausch.
Ann-Kristin Beinlich: Es wäre schön, wenn es dafür unterstützende Strukturen und Rahmungen gebe. Hier stehen sich die jeweiligen Förderlogiken momentan eher entgegen.
Vielen Dank für das Gespräch!
Quelle: IN VIA Deutschland im Netzwerk der BAG KJS – Das Interview führte Elise Bohlen von IN VIA Deutschland.