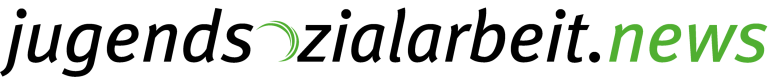‚Neue Kooperationen zwischen Schule und Arbeitswelt‘ Informationen zur gemeinsamen Fachtagung der Programme: „Kompetenzen fördern – Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf“ (BQF), „Lernende Regionen – Förderung von Netzwerken“ sowie „Schule – Wirtschaft/Arbeitsleben“ (SWA) in Bonn/ Bad Honnef, 13./ 14. Juni 2005 Auszüge aus der Dokumentation: Aus dem Vortrag von Prof. Dr. Manfred Eckert, Universität Erfurt, Fachgebiet für Berufspädagogik und berufliche Weiterbildung: “ Übergangsmanagement in Schule, Ausbildung und Beruf Übergangsmanagement – ein technisches Problem? Übergangs’management‘ ist eine moderne Formulierung. Der Management-Begriff ist heute weit verbreitet: Begriffe wie Selbstmanagement, Sozialmanagement, Bildungsmanagement zeigen das instrumentalistische Verhältnis des modernen Menschen zu sich selbst und seiner sozialen Umgebung. Sie wecken die Vermutung, dass es sich hier immer nur um technische Probleme handelt. Dieser Assoziation folgend drängt sich die provozierende Vorstellung auf, es gehe beim „Übergangsmanagement„ um die Fertigung von „Übergängen„, von Anschlussstücken für Aggregate, die miteinander verbunden werden müssen, aber noch nicht so richtig zueinander passen. Im technischen Bereich würde man jetzt von Adaptern reden, die diese Verbindungen herstellen. Technische Aggregate, die aneinander angeschlossen werden sollen, müssen drei verschiedene Bedingungen erfüllen: 1. Sie müssen, wenn sie miteinander verbunden sind, etwas sinnvolles ergeben. 2. Die Verbindungsstücke müssen zueinander passen. 3. Die internen Prozesse müssen aufeinander abgestimmt sein. Diese drei Problemfelder sind der Gegenstand von „Übergangsmanagement„. Dabei sind – um im Bild zu bleiben – die Verbindungsstücke ein technisch zu lösendes Problem. Was aber ein sinnvoller Zusammenhang der Systeme ist und in welcher Weise die internen Prozesse aufeinander abzustimmen sind, das lässt sich keineswegs nur technisch klären. Bildungsinstitutionen, Ausbildungseinrichtungen und Beschäftigungssysteme sind ausserordentlich schwierig aufeinander abzustimmen. Trotzdem funktionieren diese Kopplungen relativ gut. Es gibt keine eklatanten Facharbeiterlücken und keine gravierenden Qualifikationsdefizite, obwohl sich niemand wirklich daran wagt, im Hinblick auf zukünftige Qualifikationsbedarfe Prognosen zu stellen. Die Kopplung von Bildungs- und Beschäftigungssystem funktioniert, weil viele flexible Größen aufeinander bezogen sind und dabei ständig nachgesteuert wird. … Die Abstimmung von Bildungs- und Beschäftigungssystem Darüber hinaus ist zu bedenken, dass die aufeinander zu beziehenden Systeme, das Bildungs- und das Beschäftigungssystem, relative Autonomie aufweisen. Es gelingt ihnen, komplexe, teils sogar widersprüchliche gesellschaftliche Funktionen zu übernehmen. Solche Widersprüche können zum Beispiel zwischen der Qualifikations- und der Selektionsfunktion von Bildungssystemen bestehen. … Diese Überlegungen sollten zeigen, dass „Übergangsmanagement„ sich nicht in einer schnellen und pragmatischen Vermittlung in Beschäftigung erschöpfen kann – auch dann nicht, wenn wir über die Benachteiligtenförderung reden, deren Teilnehmer ja weniger auf eine besondere Karriere vorbereitet, sondern zunächst nur vor drohender Arbeitslosigkeit bewahrt werden sollen. Trotzdem muss auch den Teilnehmern der Benachteiligtenförderung durch die berufliche Qualifizierung der Start in das Berufsleben gelingen, und dieses Berufsleben ist für sie keineswegs kürzer und auch nicht einfacher zu bewältigen als das von Menschen mit besseren Startchancen und Karrierewegen. „Übergangsmanagement„ und Individualisierung Übergangsmanagement kann schließlich auch deswegen kein technisches Problem sein, weil Übergänge immer von jedem einzelnen Menschen in einer individuellen Weise bewältigt werden müssen. Die Wahl von Beruf und Arbeitsplatz, auch die Bewältigung von Bewerbungssituationen, ist ein hoch individualisiertes Geschehen, das sich fast gar nicht standardisieren lässt. Andererseits sind die Menschen selbst keine Aggregate: ihre Entwicklungsprozesse sind nicht eindeutig determiniert, sie sind offen – aber sie sind auf förderliche Rahmenbedingungen angewiesen. Darin liegt der pädagogische Auftrag, der auch und gerade die pädagogische Arbeit in der Benachteiligtenförderung prägt. Werden diese Überlegungen in einen schultheoretischen Kontext übersetzt, dann zeigt sich erneut, dass die Vorstellung einer Optimierung der Übergänge möglicherweise pädagogisch kaum sinnvoll ist. Einerseits hat jede Form von Schule immer den Auftrag und den Anspruch, auf das spätere Leben vorzubereiten. „Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir„ hieß der Leitsatz, der in seiner lateinischen Fassung des öfteren plakativ über den Schultüren stand. Da aber in modernen Gesellschaften das Leben ganz besonders durch Übergänge vielfältigster Art geprägt ist, muss jede Vorbereitung auf „das Leben„ zugleich auch auf diese Übergänge vorbereiten. Kurz gefasst heisst das: Alle Bildungsprozesse sind auch Vorbereitungen auf (biografische) Übergänge. Anders herum betrachtet sind die Erfahrungen von gelingenden Übergängen die unabdingbare Voraussetzung für erfolgreiche Bildungs- und Entwicklungsprozesse. Aus der ökologischen Sozialisationsforschung ist hinreichend bekannt, dass die vielschichtige Vernetzung sozialer Systeme in der Erlebnis- und Erfahrungswelt junger Menschen eine Voraussetzung für gelingende individuelle Sozialisations- und Entwicklungsprozesse ist. Freilich geht es hier nicht darum, solche Übergänge zu „managen„, sie möglichst reibungslos zu gestalten und Passfähigkeit herzustellen, sondern um das Erschließen neuer Erfahrungswelten und deren Vernetzung mit den entsprechenden Vorerfahrungen und den sozialen Systemen, in denen diese Vorerfahrungen gewonnen worden sind. Schon eine oberflächliche Betrachtung zeigt die Vielfalt dieser Übergänge und Schwellen: Vom Elternhaus in den Kindergarten, vom Kindergarten in die Schule, von der Primarstufe in die Sekundarstufe I, von der Sekundarstufe I in die Berufsausbildung, von dort in Beschäftigung, von einem Beschäftigungsverhältnis zum nächsten (vielleicht auch durch Arbeitslosigkeit unterbrochen), und schließlich der zeitweise oder endgültige Ausstiege aus dem Arbeitsleben. Der Übergang von der Schule in die Arbeitswelt Ein zentrales Thema, um dass es bei dieser Fachtagung geht, ist der Übergang von der Schule in die Arbeitswelt. In der alten Volksschule war dieses Thema kein Problem. Im Rahmen der ihr eigenen Didaktik der volkstümlichen Bildung und des damit verbundenen Kunde-Prinzips, der Heimat- und Sachkunde, der Gesellschafts- und Wirtschaftskunde, war ein unmittelbarer Bezug zu den nahen Lebens- und Erfahrungswelten der jungen Menschen wie selbstverständlich gegeben. In ganz anderer, expliziter Weise war dieser Übergang in die Arbeitswelt das Thema der „Hauptschule„, die der Deutsche Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen in seinem einschlägigen Gutachten von 1964 an die Stelle der Volksschule setzen wollte. Hier war die Arbeitslehre als didaktisches Zentrum der oberen Klassen der Hauptschule vorgesehen. In diesem Zusammenhang hat sich eine sehr intensive Diskussion um die „Arbeitslehre„, teils auch als „Polytechnik„ bezeichnet, entwickelt. Dabei war Arbeitslehre zugleich immer auch ein Politikum. In manchen didaktischen Ansätzen sollten – keineswegs unbegründet – die Interessen der lohnabhängigen Arbeitnehmer explizit im Mittelpunkt stehen. Daraus haben sich im bildungspolitischen Raum Kontroversen ergeben, die das Anliegen der Arbeitslehre nicht gefördert haben. Geblieben ist ein Torso, eine Fächerkombination von Arbeit, Wirtschaft, Hauswirtschaft und Technik, der der innere Zusammenhang weitgehend abhanden gekommen ist und der keineswegs das „didaktische Zentrum„ der Hauptschule geworden ist. Unverändert stehen die traditionellen Einzelfächer im Mittelpunkt der Didaktik und der Lehrerausbildung. Das Dilemma der Schule: Allgemeine oder individuelle Bildung? Durch die Fächerzentrierung der Schule wird eine Didaktik vertreten, die das Fach und das Fachliche ins Zentrum der Bildungsarbeit stellt. Dabei zielt doch Bildungstheorie, die diese Bildungsarbeit begründen sollte, immer auf individuelle Entfaltung jedes einzelnen Menschen im Horizont von Gesellschaft, Kultur und Geschichte. Das ließe sich bei Comenius, Herder, Humboldt, Schleiermacher, auch bei Kerschensteiner, Spranger und bei Blankertz immer wieder neu zeigen. So ist zwar der individuelle Bildungsanspruch klar formuliert, aber Schulen sind allgemeine Bildungsanstalten, sie sind politisch gesteuerte Institutionen zur Sozialisation und Integration der nächsten Generation in die Gesellschaft. Diese Funktion wird über die Lehrpläne vermittelt. … Dass diese Vorgänge alle sehr „kopflastig„ sind, gilt uns als Selbstverständlichkeit. Das Wissen über die Welt ist die Voraussetzung für die Bewältigung der Welt – und damit auch die Voraussetzung von Bildung selbst. Möglicherweise handelt es sich hier um einen scholastischen Rest in unserem Bildungsverständnis und in unserem Bildungssystem: die Entfaltung des Menschlichen über das Wissen. Es könnte aber auch sein, dass diese Einstellung eine Folge der modernen (erfahrungs-) wissenschaftlichen Weltdeutung ist. Individualisierung ist in diesem Konzept vom Grundsatz her kaum vorgesehen. Andererseits erfordert Schule doch wiederum individuelle Differenzierungsleistungen: Jeder junge Mensch muss im differenzierten Bildungssystem die für ihn „passende„ Schule finden. Berufsbildungstheoretisch zugespitzt geht diese Individualisierung noch viel weiter: jeder Mensch muss „seinen„ Beruf wählen und finden. Nicht zufällig ist in den Grundrechten des Grundgesetzes, in Artikel 12 verankert: „Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen„. Das ist eine Konkretisierung der individuellen Freiheitsrechte unserer Verfassung. Das heißt auch: Jeder Mensch muss seine eigene Biographie gestalten. Staatliche Berufslenkungsprozesse, wie sie in der DDR möglich waren, sind hier nicht vorgesehen. Allerdings gibt es auch nicht das Recht auf Arbeit, wie es in der Verfassung der DDR verankert war. Berufswahl – oder Einmündung in Arbeit? Verbunden mit dem Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und dem Sozialstaatsgebot ist das Recht der freien Berufswahl mehr als nur ein Freiheitsrecht, das die Eingriffshoheit des Staates begrenzt. Vielmehr ist die Auslegung zulässig, dass der Staat selbst zur Förderung der Rahmenbedingungen beizutragen habe, damit dieses Recht nicht nur formal ausgewiesen, sondern auch realisiert werden kann. Insofern ist die Förderung der Berufswahl eine sozialstaatliche und damit auch eine politische Aufgabe. Darüber hinaus ist die Förderung der Integration in die Arbeitswelt auch eine Aufgabe der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, der Bildungspolitik und vielleicht auch der Finanzpolitik. Wenn man dieser Argumentation folgt, dann besteht zwischen einer Politik, die auf berufliche Qualifizierung setzt, und einer Politik, die dieses Ziel zugunsten einer Einmündung in Beschäftigung relativiert, ein ganz erheblicher qualitativer Unterschied. Letztere trägt zur Realisierung des Grundrechts auf freie Berufswahl kaum etwas bei und ist deshalb mehr als fragwürdig. „Meine„ Berufswahl – ein individualisiertes Geschehen Wenngleich hier die Politik in die Verantwortung genommen wird, die Bedingungen für eine freie Berufswahl mit herzustellen, so bleibt doch die unhintergehbare Tatsache, dass die Berufswahl immer ein höchst individualisiertes Geschehen ist. Richtig ist die These: „Ich suche �meinen’ Beruf, nicht �einen’ Beruf„. Daran knüpft immer gleich die Frage an: „Wie finde ich �meinen’ Beruf?„ und weiter: „Wie finde ich (m)eine Ausbildungsstelle?„ Anders gewendet heißt das: Es geht bei der Berufswahl nicht um irgend einen Beruf und irgend eine Ausbildungsstelle. Diese Tatsache macht auch den Berufswahlunterricht in der Praxis so schwierig. Alle berufsorientierenden Angebote, die den einzelnen Schüler oder die einzelne Schülerin nicht individuell ansprechen, interessieren gar nicht, sie sind im engsten Sinne langweilig. Was nicht geht Aus diesen Überlegungen wird deutlich, dass es im Berufswahlkontext nicht sinnvoll ist, Schülerinnen oder Schüler irgendein Praktikum in irgendeinem Beruf anzubieten. Gleiches gilt für Exkursionen in Betriebe und Verwaltungen: Interessant ist, was „ich„ für mich wissen und kennenlernen möchte und was für mich erreichbar und attraktiv ist. Generalisierend formuliert heißt das: Alle berufsvorbereitenden Bildungsangebote müssen ein sehr hohes Maß an Individualisierung aufweisen, damit sie auf das Interesse der je einzelnen Schülerin und des je einzelnen Schülers stoßen. Ebenso wenig sinnvoll ist es, auf Leistungsanforderungen und Schulabschlüsse hinzuweisen oder hinzuarbeiten, die sich Schülerinnen und Schüler ohnehin nicht zutrauen. So kann es auch nicht darauf ankommen, jungen Menschen irgend eine Ausbildung in irgend einem Betrieb zu vermitteln – häufig geht das ohnehin schief, und ein Teil der viel zu hohen Abbrecherquote wird auch in dieser unrealistischen, aber allzu oft propagierten (Fehl-.)Entscheidung seine Ursache haben. Schließlich gilt gleiches auch für die beruflichen Schulen: Irgendeine (berufliche) Schule zu besuchen, deren Inhalte die Schülerin oder den Schüler ohnehin nicht interessieren, die sich selbst vielleicht auch nur als „Auffangbecken„ versteht und die nicht weiterführt, hat weder einen Sinn noch den geringsten motivierenden Effekt. Ein „Übergangsmanagement„, das zu solchen Strategien greift, ist zur Erfolglosigkeit verurteilt. Was geht Es hilft wenig, Absolventinnen und Absolventen der allgemeinbildenden Schulen solchen ungewünschten Maßnahmen und Angeboten zuzuweisen oder sie mit der Berufsschulpflicht in die Schule hinein zu zwingen. Weitaus Erfolg versprechender wäre es, dafür zu sorgen, dass wenigstens ein geringes Maß an Freiwilligkeit bei der Zugangsentscheidung realisiert werden kann. Freiwilligkeit meint hier weniger die Entscheidung, ob eine Berufsausbildung aufgenommen wird oder nicht – alle einschlägigen Studien weisen immer wieder darauf hin, dass junge Menschen die Berufsausbildung als außerordentlich wichtig einschätzen – Freiwilligkeit meint die Alternative und die Wahl, sich für das entscheiden zu können, was den individuellen Wünschen und Möglichkeiten entspricht. Folglich sollte der Besuch einer beruflichen Schule oder einer beruflichen Maßnahme soweit wie möglich freiwillig sein. Das heißt konkret: es sollte immer Entscheidungsalternativen geben. Der Besuch eines Bildungsangebots sollte immer darauf abzielen: einen Abschluss zu bieten, der berufliche Chancen öffnet, die Lern- und Entwicklungsprozesse zu individualisieren, explizit die Frage aufzunehmen und zu klären, wie es hinterher beruflich weiter gehen kann, neue Horizonte zu eröffnen (Erkundungen, Praktika, Ausbildungschancen) und soweit es sich um Berufsvorbereitung handelt, berufliche und allgemeine Bildung (Schulabschluss) mit einander zu verbinden. Insgesamt ist diese Darstellung ein Plädoyer für Individualisierung und für eine Orientierung, die häufig nur für die Bildung von Eliten eingefordert wird: Schulen und Bildungsangebote müssen Karrierewege eröffnen, und seien es auch nur die objektiv bescheidenen, aber individuell höchst bedeutsamen Wege in eine qualifizierte Ausbildung und Beschäftigung. Das neue Fachkonzept zur Berufsvorbereitung der Bundesagentur für Arbeit oder: Die Dialektik der Individualisierung Im vergangenen Jahr hat die Bundesagentur für Arbeit das neue Fachkonzept zur Berufsvorbereitung veröffentlicht, im Herbst werden voraussichtlich alle einschlägigen Maßnahmen auf dieses Konzept umgestellt sein. Wenngleich noch Änderungen zu erwarten sind, wird das Grundkonzept sicher Bestand haben. Dabei ist das Eignungsfeststellungsverfahren zu einem Kernstück der Berufsvorbereitung geworden, und die sich daran anschließende Orientierungs- und Qualifizierungsphase wird – so ist zu hoffen – in vielen Bereichen das Individualisierungspotential steigern. Im Verbund mit individuellen Förderplänen könnte hier ein wirklich neues Förderkonzept entstehen, wenn – wie oben bereits angesprochen – eine Angebotsvielfalt gegeben ist, die wirklich individuelle Entscheidungen zulässt. So könnte gesichert werden, dass nicht nur neue „Formalitäten„ eingeführt werden, sondern substanzielle Veränderungen eintreten. Die Kehrseite dieser Entwicklung ist die Orientierung an „Beschäftigungsfähigkeit„, mit dem modernen Begriff „employability„ salopp umschrieben. Im klassischen berufspädagogischen Vokabular ausgedrückt geht es hier um nichts anderes als eine neue Jungarbeiterschule. Deren Aufrüstung mit Qualifizierungsbausteinen könnte sehr schnell zu einer Anlernausbildung in neuem Gewand werden, die doch schon in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts eigentlich der Vergangenheit angehören sollte. Hier liegen große Bildungs-, Qualifizierungs- und Beschäftigungsrisiken. Die Gefahr der vorschnellen Selektion und Dequalifizierung einer sehr förderbedürftigen Gruppe von jungen Menschen darf keinesfalls unterschätzt werden. Damit ist zugleich das Risiko und die Dialektik der Individualisierung herausgestellt. Bietet schon das Konzept des Berufs ein Individualisierungspotential – das aus berufspädagogischer Sicht immer ein wichtiger Bestandteil der Bildungskraft des Berufes ist – so ist die „Beschäftigungsfähigkeit„ eine Potenzierung der Individualisierung: Sie zielt auf absolut individuelle Passung des Einzelnen in Bezug auf den einzelnen Arbeitsplatz. Dass eine Sammlung von absolvierten Qualifizierungsbausteinen aber keine Berufsausbildung ist, dass eine Berufsausbildung Teil eines Bildungsprozesses ist, dass die Konzepte der Schlüsselqualifikationen und der Kompetenzentwicklung die Flexibilität und Zukunftsfähigkeit dieses Bildungsprozesses sichern, gerät aus dem Blick, wenn nur noch mit „Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit„ gehandelt wird. Hier könnte eine Form der Deregulierung und Neo-Liberalisierung in die Berufsbildung Einzug halten, die in letzter Konsequenz den Staat von der Pflicht dispensiert, ergänzend zur Wirtschaft in die berufliche Bildung der Jugendlichen der unteren Schichten zu investieren. Freilich muss diese Entwicklung nicht eintreten. Individualisierung enthält ebenso viel Potential, individuell zu fördern (und zu fordern) und entsprechende Bildungsprozesse auf eine gute Weise zu gestalten. Dass mit einem erfolgreichen Berufsabschluss auch eine erfolgsträchtige Option für einen späteren Berufswechsel und für berufliche Weiterbildung eröffnet ist, steht völlig außer Frage. Die systematische Erfassung von individuellem Entwicklungsstand und Entwicklungsfortschritt bietet einerseits neue pädagogisch-didaktische Anknüpfungspunkte für einen individualisierten Lern- und Bildungsprozess. Andererseits besteht die Chance, diese Form der Individualisierung auch als Qualitätskriterium an die institutionelle Struktur von Bildungsangeboten anzulegen. Am Beispiel des Berufswahlpasses lässt sich das zeigen: Handelt es sich hier um den individuellen Nachweis entsprechender Aktivitäten oder um ein institutionenbezogenes Qualitätskriterium, mit dem geprüft werden kann, ob die entsprechenden Bildungseinrichtungen die Berufswahl nachhaltig gefördert haben? Beides wäre höchst sinnvoll. Daran wird auch deutlich, dass „Übergangsmanagement „ sowohl eine individuelle als auch eine institutionelle Seite hat. Die individuelle und die institutionelle Seite des Übergangsmanagements In individueller Hinsicht muss „Übergangsmanagement„ Fragen der Kompetenzentwicklung in den Mittelpunkt stellen. Dieser Gedanke ist nicht neu, aber in den Denkstrukturen einer Pädagogik der Schule nicht hinreichend verankert. Kompetenzerfassung heißt nicht, Leistungsstandards durch „Klassenarbeiten„ abzufragen und selektionswirksam werden zu lassen, sondern einen Ist-Stand zu ermitteln und die Entwicklungspotentiale herauszuarbeiten, an den Förderung anzuknüpfen hat. Förderung heißt auch, die Fähigkeit zu Selbststeuerung und Selbstreflexion anzuleiten und Lernumgebungen zu schaffen und auszudiffererenzieren, in denen solche Lernprozesse erst ermöglicht werden. Damit gerät auch die institutionelle Seite des Übergangsmanagements in den Blick. Hier muss zunächst festgehalten werden, dass das duale Berufsbildungssystem nach wie vor eine sehr große Anzahl junger Menschen mit qualifizierten Ausbildungsplätzen versorgt. Diese Leistung sollte von politischer und staatlicher Seite nicht in Frage gestellt werden. Andererseits ist ebenso richtig, dass das duale Berufsbildungssystem zu wenig junge Menschen mit Ausbildungsstellen versorgt – und dass es eine hohe Quote an Unversorgten und an Abbrechern aufweist. Hier liegen die zentralen Aufgabenfelder des Übergangsmanagements. Es muss sich in besonderer Weise auf die hier angesprochenen Personengruppen richten und die damit verbundenen Herausforderungen annehmen. Die schlichte Form der Modularisierung von Ausbildungsabschnitten anhand kurzfristiger einzelbetrieblicher Interessen und die kurzschlüssige Entwicklung von anspruchsarmen Qualifikationsbausteinen zählen sicher nicht zu einem guten Übergangsmanagement. Die regionalpolitische Seite des Übergangsmanagements Die Idee des Übergangsmanagements und die Dialektik der Individualisierung zielen beide gleichermaßen auf vielfältige Angebote und auf deren Vernetzung als Maxime für neue Kooperationsformen und Abstimmungen. Dabei heißt Kooperation wohl nicht nur das Zusammenarbeiten von Bildungsanbietern, um die Zugangswege und die Bildungsgänge zu individualisieren, sondern auch, neue Kooperationsformen zur Erschließung von Ausbildungs- und Beschäftigungspotentialen zu entwickeln. Solche Formen finden sich zum Beispiel: in den Kooperationen Schule/Bildungsträger – Wirtschaft in Ausbildungsverbünden in der „Re-Dualisierung„ der Benachteiligtenförderung in neuen Formen vollzeitschulischer Berufsbildung in der Entwicklung von weiterbildenden (.) Qualifizierungsbausteinen und deren Vernetzung mit den regionalen Arbeitsmärkten. Bemerkenswert ist, dass hier über die Förderung regionaler Bildungsarbeit auch regionale Entwicklungspotentiale freigesetzt werden können, die – gerade aufgrund des in den neuen Bundesländern bevorstehenden demographischen Abschwungs – von erheblicher Bedeutung sein können. Die politische Seite des Übergangsmanagements Übergangsmanagement hat nicht zuletzt auch facettenreiche politische Seiten. Zuerst geht es um Bildungs- und Berufsbildungspolitik. Wenngleich eine rechtliche Grundlage nicht gegeben ist, hat die Maxime „Ausbildung für alle„ mit der die Ausbildungsstellenaktionen der Bundesregierung in den letzten Jahren propagiert worden sind, den richtigen Zuschnitt getroffen. Darüber hinaus ist Ausbildungspolitik auch ein Teil von Sozialpolitik, weil die Teilhabe an den sozialen Systemen und an gesellschaftlicher Integration über Beruf und Arbeit erfolgt. Weiter ist sie ein Teil von Arbeitsmarktpolitik, die auf die Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit und auf die Bereitstellung von verwertbaren Arbeitskräften zielt. Nicht zuletzt ist der Erfolg aller dieser Aktionen ein Teil einer guten Finanzpolitik, weil er die Haushalte entlastet. Individualisiertes Übergangsmangement Berufsintegration ist ein individueller Prozess – darauf ist ausführlich eingegangen worden. Bisher steht dieser Prozess aber in einer individuellen, persönlichen, vielleicht sogar privaten Verantwortung. Die kritische Frage ist, ob sich dieser individualisierte Prozess auch institutionell systematisch und individuell fördern lässt. Ist es denkbar, dass jeder Teilnehmer „seine„ eigene Bildungsmaßnahme erhält, ohne dass dabei das Ziel der Berufsqualifizierung außer Acht gelassen wird? Anders gefragt: Ist eine Individualisierung der Bildungsinstitutionen denkbar und möglich? Konkret würde das heißen: Kann es eine Maßnahme für einen einzelnen Teilnehmer geben? Und schließlich käme als letzte Frage hinzu: Ist eine Individualisierung der Abstimmung der Systeme, des Ausbildungs- und des Beschäftigungssystems, denkbar und möglich? Das liefe auf eine Abstimmung für jeden einzelnen Teilnehmer, vielleicht auch für jeden einzelnen Arbeitgeber hinaus. Die Entwürfe der Hartz-Reformen mit ihren neu gestalten Job-Centern und ihren Fall-Managern, mit individuellem ‚Fördern Fordern‘, weisen genau in diese Richtung. In welchem Umfang und in welcher Form sie Wirklichkeit werden, soll hier nicht gemutmaßt werden. Sie zeigen genau auf das hier zu diskutierende Problem. Heißt „Übergangsmanagement„ eine beschleunigte und kurzfristige Brauchbarmachung junger Menschen für Arbeitsmärkte und Arbeitsplätze? Oder geht es darum, die individuellen Qualifizierungs- und Berufsverläufe so in institutionelle Angebote zu übersetzen, dass diese Individualisierung im Sinne einer Potentialentwicklung und einer beruflichen Qualifizierung durch die Bildungsinstitutionen selbst zum Programm gemacht und umgesetzt wird? … “
Quelle: Die komplette Dokumentation der Veranstaltung ist online abrufbar unter: http://www.swa-programm.de/tagungen/badhonnef/index_html