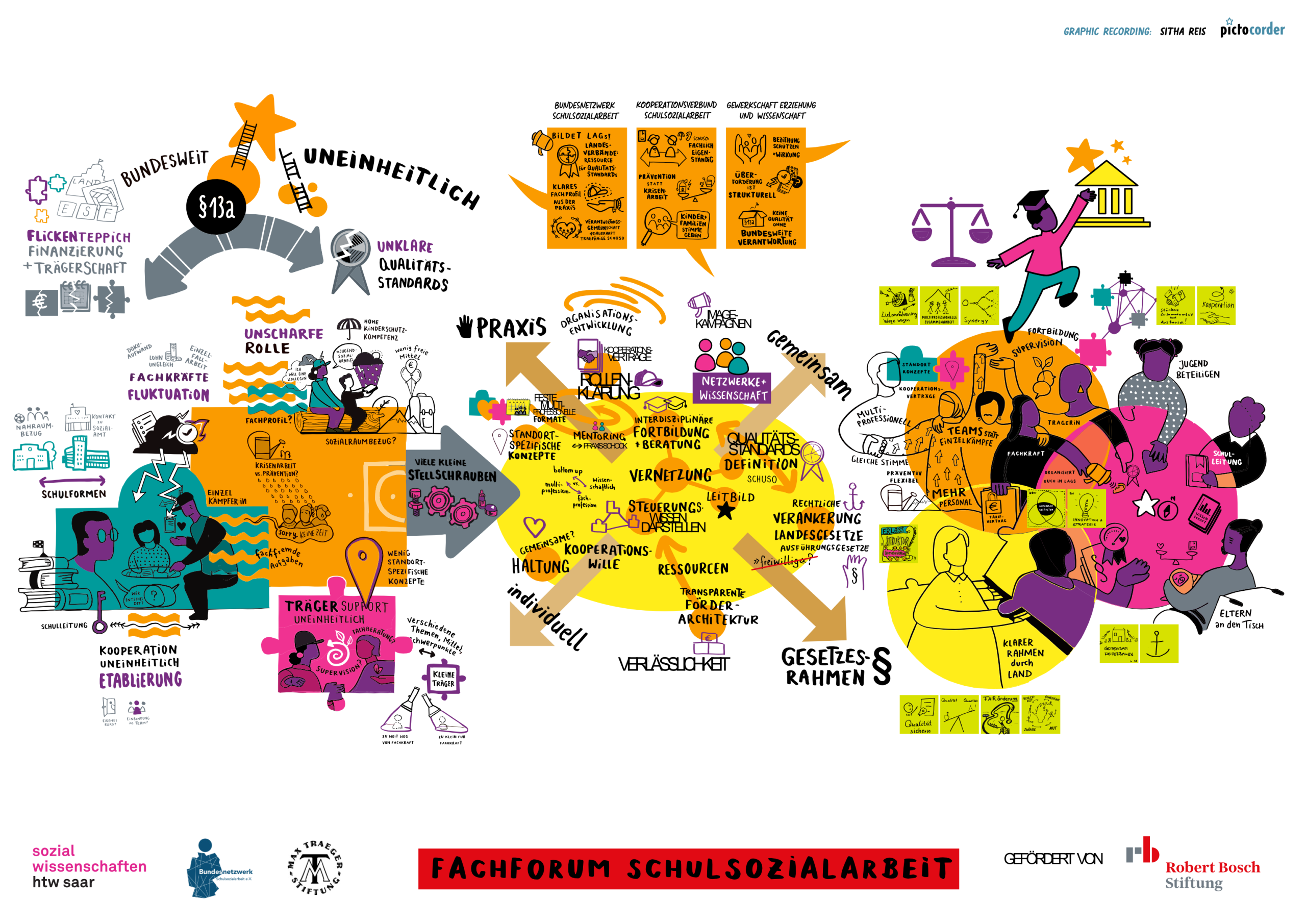Die Expertise gliedert sich in folgende Abschnitte: In einem ersten Schritt wird die schulstatistische Ausgangslage dargestellt und kurz analysiert. Im zweiten Schritt folgt ein systematisierender Überblick über inklusionsbedingte Veränderungen der Bildungsausgaben. Mit Blick auf den Schwerpunkt der Studie werden im dritten Abschnitt drei Varianten zur Berechnung inklusionsbedingter Veränderungen der Ausgaben für Lehrkräfte vorgestellt, das methodische Vorgehen erläutert und drei Varianten der Berechnungen dargestellt. Im vierten Abschnitt werden die Ergebnisse zusammenfassend eingeordnet.
Auszüge aus den Ergebnissen der Expertise Zusätzliche Ausgaben für ein inklusives Schulsystem in Deutschland von Prof. em. Dr. Klaus Klemm im Auftrag der Bertelsmann Stiftung:
“ … Schulstatistische Ausgangslage
Deutschlandweit wurden im Schuljahr 2009/10 etwa 485.000 Schülerinnen und Schüler mit einem diagnostizierten sonderpädagogischen Förderbedarf in allgemeinbildenden Schulen unterrichtet:
knapp 388.000 in eigens dafür eingerichteten Förderschulen und knapp 98.000 (also mit einem Inklusionsanteil von 20,1 %) in allgemeinen Schulen. Insgesamt ergibt sich damit für Deutschland eine Förderquote von 6,2 Prozent.
Diese Förderquote – so definiert die Kultusministerkonferenz (KMK) – gibt den Anteil an, den alle Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an der Gesamtheit aller Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 10 haben. Die Zerlegung der Förderquote in eine Exklusionsquote, also den Anteil der in Förderschulen unterrichteten Kinder und Jugendlichen an allen Schülern der Jahrgangsstufen 1 bis 10, und in die Inklusionsquote, die diesen Anteil für die in allgemeinen Schulen unterrichteten Schüler mit diagnostiziertem sonderpädagogischem Förderbedarf angibt, zeigt: In Deutschland werden fünf Prozent der Schüler der Klassen 1 bis 10 in Förderschulen unterrichtet. Weitere 1,2 Prozent werden bei einer diagnostizierten Förderungsbedürftigkeit inklusiv (also in allgemeinen Schulen) betreut und unterrichtet. Bei der Bewertung dieser Inklusionsquote muss beachtet werden, dass unter „Inklusion“ im Vergleich der Bundesländer sehr unterschiedliche Konzeptionen zusammengefasst und verstanden werden.
Bei einem Vergleich der Bundesländer wird deutlich, dass sich bei der allgemeinen Förderquote eine Spreizung findet: von 4,7 Prozent in Rheinland-Pfalz bis hin zu 11,9 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern. Noch größer ist die Spannweite bei den Inklusionsanteilen, die von 7,2 Prozent in Niedersachsen bis hin zu 45,5 Prozent in Schleswig-Holstein reichen. Infolge unterschiedlicher Förderquoten und unterschiedlicher Inklusionsanteile ergibt sich, dass Schleswig-Holstein nur 2,9 Prozent der entsprechenden Altersgruppe in Förderschulen unterrichtet (Exklusionsquote), während in Mecklenburg-Vorpommern 8,9 Prozent der Altersgruppe „exklusiv“ in Förderschulen lernen.
Die – für Deutschland insgesamt – … Verteilung der Kinder und Jugendlichen mit Förderbedarf auf die unterschiedlichen Förderschwerpunkte zeigt zum einen, dass mit 42,6 Prozent mehr als zwei Fünftel dem Förderschwerpunkt Lernen zugerechnet werden. Die weiteren Schwerpunkte sind deutlich geringer gewichtet. …
Inklusionsbedingte Veränderungen der Bildungsausgaben
Mit Artikel 24 der seit 2009 in Deutschland geltenden UN-Behindertenrechtskonvention ist geregelt, dass Deutschland verpflichtet ist, jedem Kind und jedem Jugendlichen inklusive Bildung zu ermöglichen. Diese Konvention hat der Diskussion um die schulische Inklusion enorm befördert und auf der Basis eines bundesdurchschnittlichen Inklusionsanteils von 20,1 Prozent in den Bundesländern zu einer unverkennbaren Ausweitung der Nachfrage nach inklusiven Schulplätzen geführt. Angesichts der damit eingeleiteten Expansion inklusiver Schulbildung stellt sich die Frage nach den zusätzlich entstehenden Bildungsausgaben – insbesondere auch deshalb, weil bisher kaum bundesweit Gültigkeit beanspruchende und belastbare Analysen zu dieser Fragestellung vorliegen. …
Die Expertise berechnet die zusätzlichen Ausgaben, die für das Lehrpersonal erforderlich sind, um ein inklusives Schulsystem hierzulande umzusetzen. Die Berechnungen konzentrieren sich auf den Personalbedarf, der im Bereich der Förderung von Schülern mit einem diagnostizierten sonderpädagogischem Förderbedarf dadurch entsteht, dass Kinder und Jugendliche, die jetzt noch in Förderschulen lernen, zukünftig vermehrt in allgemeinen Schulen (und damit nicht mehr in einem gesonderten Förderschulsystem) unterrichtet werden. Die vorgelegten Berechnungen gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2020 alle Schüler aus den Förderschwerpunkten „Lernen“, „Emotionale und soziale Entwicklung“ sowie „Sprache“ und 50 Prozent derjenigen, die derzeit noch in den übrigen Förderschwerpunkten in Förderschulen lernen, an allgemeinen Schulen inklusiv unterrichtet werden.
Angesichts des Geburtenrückgangs kann damit gerechnet werden, dass bis 2020 ca. 8000 Lehrervollzeitstellen an Förderschulen „frei“ werden – Experten sprechen in diesem Zusammenhang von der demographischen Rendite des Förderschulsystems. Diese wird als Grundlage für die Berechnung von drei Varianten der Personalausstattung für Deutschland und für jedes der 16 Bundesländer verwendet.
In der ersten Variante wird berechnet, wie viele Lehrervollzeitstellen zusätzlich zu den 8.000 frei werdenden Stellen aus der demographischen Rendite des Förderschulsystems geschaffen werden müssen, um die Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den allgemeinen Schulen zu unterrichten, ohne die bisherige zusätzliche Förderung, wie sie derzeit im Rahmen des Sonderschulsystems erfolgt, einzukürzen. …
Der Anstieg des inklusiven Unterrichts – wenn er das bis 2020/21 beschriebene Ausmaß erreichen soll – führt zusätzlich zu den durch die demographische Rendite bundesweit frei werdenden 8.000 Stellen gegenüber dem Bestand des Schuljahres 2009/10 zu einem weiteren Mehrbedarf von insgesamt rund 9.300 Stellen. Diese Variante 1 hat bundesweit jährliche Mehrausgaben von etwa 0,66 Milliarden Euro gegenüber 2009/10 zur Folge.
Die zweite Variante geht von einer Deckelung der Stellen aus: Die 8.000 demographisch bedingt frei werdenden Stellen aus dem Förderschulwesen verbleiben im vollen Umfang auch weiterhin für die sonderpädagogische Förderung im Rahmen der angestrebten inklusiven Beschulung; ein Mehrbedarf für sonderpädagogische Förderung wird allerdings nicht berücksichtigt. Rechnet man dies auf die Zeit um, die die Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zusätzlich an die Regelschule „mitbringen“, so ergäben sich im deutschen Durchschnitt für jeden Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen zusätzliche 2,6 Unterrichtsstunden pro Woche und für jeden Schüler mit einem anderen Förderschwerpunkt im Durchschnitt über alle Förderschwerpunkte zusätzliche 3,6 Unterrichtsstunden pro Woche.
Bei dieser Annahme ergibt sich bis 2020/21 gegenüber dem Schuljahr 2009/10 kein personeller Mehrbedarf und es ergeben sich somit auch keine inklusionsbedingten Mehr- oder Minderausgaben für Lehrkräfte. In diesem Ansatz muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Bundesländer mit unterschiedlichen demographischen Renditen aus dem Förderschulwesen rechnen und damit zum Teil auch Mehrinvestitionen vornehmen müssen. Um diese bundesslandspezifischen Besonderheiten berücksichtigen zu können, wird eine dritte Variante gerechnet.
Variante 3 berücksichtigt die unterschiedlichen Entwicklungen der Schülerzahlen in den Bundesländern in den kommenden Jahren: Länder wie Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen sehen sich mit stagnierenden bzw. mit steigenden Schülerzahlen konfrontiert und werden deshalb beim Umbau des Bildungswesens nicht auf frei werdende Personalressourcen aufgrund einer demographischen Rendite zurückgreifen können. Um den in Variante 2 skizzierten Förderansatz von zusätzlichen 2,6 bzw. 3,6 Wochenstunden Unterrichtszeit je inklusiv beschulten Schüler mit besonderem Förderbedarf zu erfüllen, müssen diese Länder zusätzliches Lehrpersonal beschäftigen. Während in dieser Variante die Länder mit demographischer Rendite ihr eingesetztes Stellenvolumen nicht verändern müssen, müssen die Bundesländer ohne Rendite im Schuljahr 2020/21 gegenüber 2009/10 etwa 3.400 Stellen zusätzlich einsetzen – und jährlich insgesamt etwa 0,24 Milliarden Euro aufbringen.
Für alle drei Varianten gilt, dass sich der Zusatzbedarf von Jahr zu Jahr erst in dem Maße aufbaut,
in dem sich die inklusive Schule in den hier unterstellten Bahnen durchsetzt. … „
Die Studie in vollem Textumfang entnehmen Sie bitte aufgeführten Links oder dem Anhang.
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-B5F58E49-81946158/bst/hs.xsl/nachrichten_111873.htm
http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_dms_35784_35785_2.pdf
http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_dms_35788_35789_2.pdf
Quelle: Bertelsmann Stiftung
Dokumente: Bertelsmann_Studie_zusaetzliche_Ausgaben_fuer_ein_inklusives_Schulsystem.pdf