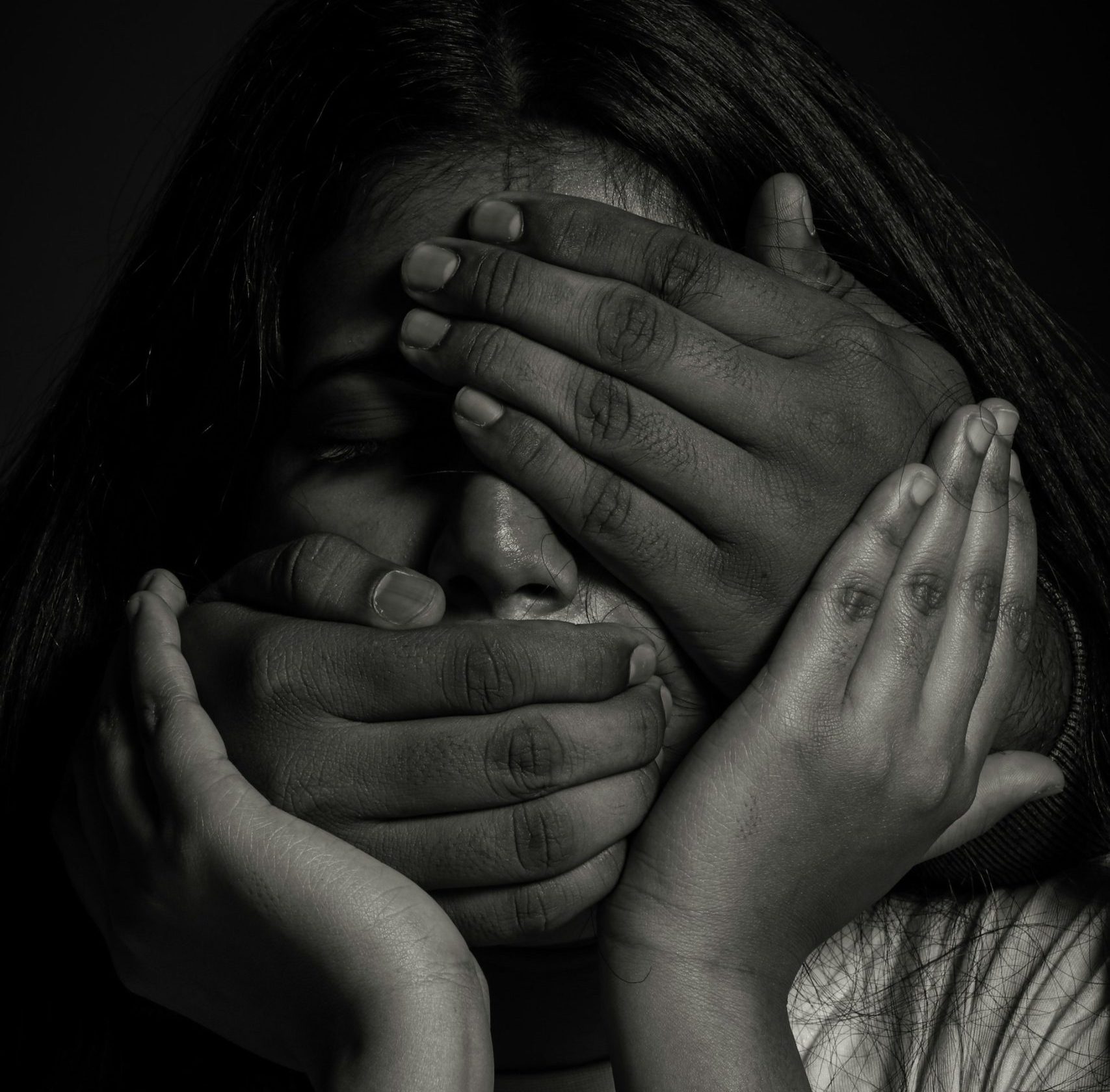Die Diskussion um die Höhe und Ausgestaltung des Hartz IV-Regelsatzes hat erneut Fahrt aufgenommen. Ausgehend von einer Klage am Berliner Sozialgericht hat dieses einen Vorlagebeschluss beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) eingereicht.
Nach Auffassung der 55. Kammer des Sozialgerichts Berlin verstoßen die Leistungen des SGB II gegen das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums. Die Kammer hat daher dem Bundesverfassungsgericht die Frage der Verfassungswidrigkeit des SGB-II-Regelbedarfs zur Prüfung vorgelegt. Zwar seien die Leistungen nicht evident unzureichend. Der Gesetzgeber habe bei der Festlegung des Regelsatzes jedoch seinen Gestaltungsspielraum verletzt. Die Referenzgruppe (untere 15 % der Alleinstehenden), anhand deren Verbrauchs die Bedarfe für Erwachsene ermittelt worden sind, sei fehlerhaft bestimmt worden. Die im Anschluss an die statistische Bedarfsermittlung vorgenommenen Kürzungen einzelner Positionen (Ausgaben für Verkehr, alkoholische Getränke, Mahlzeiten in Gaststätten und Kantinen, Schnittblumen u.s.w) seien ungerechtfertigt. Insbesondere habe der Gesetzgeber dabei den Aspekt der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben unzureichend gewürdigt. Im Ergebnis seien die Leistungen für einen Alleinstehenden um monatlich rund 36 Euro und für eine dreiköpfige Familie (Eltern und 16-jähriger Sohn) um monatlich rund 100 Euro zu niedrig bemessen.
Das Bundesverfassungsgericht habe dem Gesetzgeber in seinem Urteil vom 9. Februar 2010 einen Gestaltungsspielraum zur Bestimmung des Existenzminimums eingeräumt. Das Gesetzgebungsverfahren müsse jedoch transparent erfolgen und methodisch und sachlich nachvollziehbar sein. Insoweit zulässig habe der Gesetzgeber zur Bemessung des Existenzminimums ein Statistikmodell verwandt, das auf einer Auswertung der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2008 (EVS 2008) beruhe.
Bereits die Auswahl der unteren 15 % der Alleinstehenden als Referenzgruppe sei jedoch mit massiven Fehlern behaftet. Sie sei ohne nachvollziehbare Wertung und damit willkürlich erfolgt. Es sei nicht begründet worden, wie aus dem Ausgabeverhalten dieser Gruppe auf eine Bedarfsdeckung der Leistungsberechtigten geschlossen werden könne. Die Referenzgruppe enthalte unter anderem auch Haushalte von Erwerbstätigen mit „aufstockendem“ Bezug von existenzsichernden Leistungen sowie Studenten im BAföG-Bezug und Fälle „versteckter Armut“. Es stelle einen unzulässigen Zirkelschluss dar, deren Ausgaben zur Grundlage der Berechnung existenzsichernder Leistungen zu machen. Darüber hinaus lasse das Ausgabeverhalten Alleinstehender keinen Schluss auf die besondere Bedarfslage von Familien zu. Nicht hinreichend statistisch belegt sei zudem, dass es mit den ermittelten Beträgen noch möglich sei, auf langlebige Gebrauchsgüter (Kühlschrank/Waschmaschine) anzusparen.
Der Beschluss der 55. Kammer ist der deutschlandweit erste Vorlagebeschluss an das Bundesverfassungsgericht, in dem es um die Klärung der Verfassungsmäßigkeit der neuen Regelsatzhöhe geht. Allein das Bundesverfassungsgericht ist befugt, ein Parlamentsgesetz für verfassungswidrig zu erklären.
Mit der Frage, was zum soziokulturellen Existenzminimum gehört, beschäftigt sich derzeit auch die Fraktion Die Linke. Laut Linke zählt der Besitz eines internetfähigen Computers auf jeden Fall dazu. Internetfähige Technik diene der Sicherung und Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen und ermögliche ein Mindesmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben. Daher fordert die Fraktion die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der sicherstellt, dass ein internetfähiger Computer in Form eines Sonderbedarfs als soziokulturelles Existenzminimum anerkannt wird.
Ob es ansgesichts dieser neu angestoßenen Diskussion lohnenswert ist, Widerspruch gegen Leistungsbescheide einzulegen oder Überprüfungsanträge für die Vergangenheit zu stellen, bleibt offen. In Internetforen wird zum Teil dazu aufgerufen bzw. diese Möglichkeiten diskutiert. Der Experte für Arbeits- und Sozialrecht, Harald Thomé hält das für wenig aussichtsreich. „Die Aussichten, dass das BVerfG die Regelleistungen rückwirkend für verfassungswidrig erklärt, sind gleich null,“ so Thomé in seinem Informationsdienst. „
tinyurl.com/6nz9pgp
Quelle: Harald Thomé; Berlin 55. Kammer Sozialgericht; Pressedienst des Deutschen Bundestages; Linksfraktion