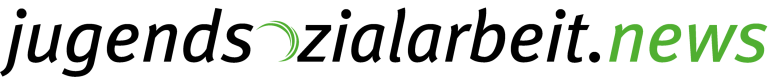Auch wenn sich die psychische Gesundheit in Deutschland innerhalb der letzten 20 Jahre verbessert hat, warnen Forscher*innen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung davor, dieser zu wenig Aufmerksamkeit zu schenken. Neben wirtschaftlichen Entwicklungen spiegelten sich soziale Ungleichheiten in der psychischen Gesundheit: Sie unterscheiden sich nach Geschlecht, Wohnort, Hochschulabschluss oder Migrationshintergrund. Dies sind die Kernergebnisse einer Studie anlässlich des Welttags für psychische Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 10. Oktober. Auf Datenbasis des Sozio-Oekonomischen Panels (SOEP) untersuchten DIW-Wissenschaftler*innen, wie sich die psychische Gesundheit in Deutschland entwickelt hat. Demnach bestehen deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen sowie zwischen Menschen in Ost- und Westdeutschland.
Aufholtrend des Ostens bei der psychischen Gesundheit?
Der Zustand psychischer Gesundheit variiere auch nach Wohnort. Menschen in Ostdeutschland hätten auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung eine schlechtere psychische Gesundheit als jene in Westdeutschland. Laut Studienautor Daniel Graeber sei zugleich ein echter Aufholtrend zu verzeichnen. Unterschiede lassen sich auch entlang der Merkmale wie Geschlecht, Bildungsabschluss oder Migrationsgeschichte festmachen.
- Frauen hatten über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg eine deutlich schlechtere psychische Gesundheit als Männer. Was sich bis 2018 angenähert hatte, wurde im Zuge der Pandemie wieder umgekehrt.
- Akademiker*innen verfügen über eine bessere psychische Gesundheit als Menschen ohne Hochschulabschluss,
- Menschen ohne Migrationshintergrund stehen etwas besser da als jene mit Migrationshintergrund.
Das häufig beschriebene soziale Gefälle der physischen Gesundheit zeige sich auch in der psychischen Gesundheit, stellen die Autor*innen fest. Wirtschaftliche Abschwünge wie der aktuelle verschlechterten im Schnitt die psychische Gesundheit der Bevölkerung. Dieser Befund sei stärker bei politischen Entscheidungen zu berücksichtigen.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit (BAG KJS) e. V. konnte in ihren Monitoren „Jugendarmut in Deutschland“ schon mehrfach belegen, dass besonders arme junge Menschen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sind. Nicht nur nehmen Krankheitsbilder wie Adipositas und Diabetes bei Jugendlichen in Haushalten mit niedrigem Einkommen signifikant zu. Hinzu kommen Konzentrationsschwäche, Essstörungen oder Depressionen, weil Sorgen wachsen und Perspektiven fehlen. In einem Politikbrief zeigt die BAG KJS, was dagegen unternommen werden kann.
Die BAG KJS beteiligt sich auch am neuen Bundesprogramm „Mental Health Coaches“. In primärpräventiven Gruppenangeboten an Schulen trainieren Schüler*innen, ihre Resilienz zu verbessern, Ressourcen zu aktivieren, Selbstfürsorge zu entwickeln, um so ihr Wohlbefinden und die mentale Gesundheit zu stärken.
Quelle: DIW: Beckmann, Mattis; Graeber, Daniel, Stacherl, Barbara: Psychische Gesundheit: Abstand zwischen Ost und West wird kleiner. In: DIW Wochenbericht 40/2023. S. 545 – 552.; BAG KJS