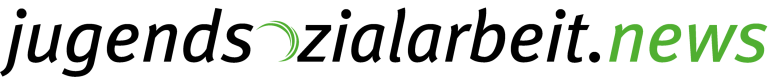In vielen Einrichtungen der Jugendsozialarbeit kehrt erst nach und nach wieder der Regelbetrieb ein. Im Kolping-Jugendwohnheim in Berlin war das anders. Man könnte sagen, die Hütte war die ganze Zeit voll. Das Team um die pädagogische Leitung Leonie Jacobi hat versucht den Betrieb trotz der Corona-Einschränkungen so gut es ging aufrecht zu erhalten. Die finanzielle Absicherung der Einrichtung und des Personals spielte eine eher geringe Rolle. Im letzten Teil der Reihe “WIE GEHT ES EIGENTLICH DEN JUGENDLICHEN…” bekommen wir eindrücklich geschildert, wie schwierig die Situation für die Bewohner*innen im Jugendwohnen während der letzten Wochen war und immer noch ist. Die Auswirkungen der Krise sind noch lange nicht vorbei. Insbesondere die ungleiche digitale Ausstattung und unzureichende finanzielle Absicherung führen zu negativen Langzeitwirkungen. Mit den „Jugendsozialarbeit News“ sprach Leonie Jacobi vom Kolping Jugendwohnen im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg.
Wie geht es den Jugendlichen? Wie gehen sie mit der Situation um?
Leonie Jacobi: Das Kolping Jugendwohnheim im Prenzlauer Berg ist die ganze Zeit geöffnet und vollbelegt gewesen. Bei uns wohnen junge Menschen dauerhaft, während sie ihre berufliche Ausbildung absolvieren. Die meisten von ihnen haben kein anderes Zuhause, auf das sie hätten ausweichen können. Über 80 % unserer Bewohner*innen sind junge Geflüchtete. Ihre Situation in den letzten Wochen war in erster Linie durch Angst geprägt. Angst in unterschiedlichen Facetten.
Vertrauenswürdige Information über die Pandemie und das mit dem Virus verbundene Risiko in der eigenen Sprache fehlten den jungen Menschen. Die unterschiedlichen Reaktionen einzelner Länder haben sie verunsichert. Wenn im Herkunftsland so agiert wird, als ob Corona keinerlei Gefahr darstelle und die Sache mit der Verbreitung Quatsch sei, ist unklar. wieso man sich in Berlin an die „Stay at Home“-Parole halten soll. Und wenn das Virus wirklich gefährlich ist, was ist dann mit meiner im Herkunftsland verbliebenen Familie? Viele unserer Jugendlichen konnten die Situation nicht realistisch einschätzen, waren ängstlich und verunsichert.
Besonders berührt hat uns jedoch die gewachsene Hilfsbereitschaft unter den Jugendlichen. Und dass sie sich trotz allem nicht entmutigen lassen und sich weiterhin den Herausforderungen stellen, einen Beruf zu erlernen und ein selbständiges Leben zu führen – auch unter erschwerten Bedingungen.
Viele Bewohner*innen werden aufgrund von Corona schlechtere Berufsabschlüsse haben.
Mit welchen Schwierigkeiten haben die Jugendlichen zu kämpfen?
Leonie Jacobi: Diese Antwort könnte jetzt ein wenig länger ausfallen. Aber mir ist wichtig, dass Sie verstehen, wie komplex die Problemlage ist. Die eben beschriebene mangelhafte Aufklärung ist nur ein Problem. Hinzu kommen noch viele weitere Herausforderungen für die jungen Menschen.
Unser Haus ist baulich nicht optimal für das Konzept des sozialpädagogisch begleiteten Jugendwohnens. Es gibt keine großen Gemeinschaftsräume und auch keine großen Freizeitmöglichkeiten. Wir verfügen lediglich über eine kleine Gemeinschaftsküche. Ansonsten sind die Jugendlichen auf ihren eigenen kleinen Bereich angewiesen. Für die Quarantäne-Fälle bedeutete das zwei Wochen auf engstem Raum nur mit sich alleine verbringen zu müssen. Das führte zu psychischen Krisen bei den Betroffenen. Und dann die Unsicherheit, was ist mit der Familie. Sind die vielleicht auch krank? Was ist, wenn das was passiert und ich bin hier „eingesperrt“?
Manche der jungen Geflüchteten haben ihre Angehörigen in anderen europäischen Ländern oder warten darauf, dass Familienmitglieder nach Deutschland nachkommen. Durch die Reiseverbote und den ausgesetzten Familiennachzug waren sie von ihren Verwandten abgeschnitten. Ausschließlich Kontakt übers Handy zu halten, war schlecht möglich. Gerade bei einer schlechten digitalen Versorgung.
Das betrifft zum einen die Voraussetzungen unseres Hauses, zum anderen die Geräte-Ausstattung der Jugendlichen. Baulich bedingt haben wir ein schlechtes W-Lan-Netz. Über einen Computerraum, den die Jugendlichen nutzen könnten, verfügt unsere Einrichtung leider bisher nicht.
Mit dem oftmals geringen Ausbildungsentgelt können sich viele unserer Bewohner*innen keine großartige technische Ausstattung leisten. Nur wenige Einzelne, die aus besser situierten Elternhäusern stammen, verfügen über ein Smartphone mit Vertrag und großem Datenvolumen sowie einen Laptop oder Drucker. Dreiviertel unsere Jugendlichen haben lediglich ein Handy mit Prepaidkarte und geringem Datenvolumen. Mehr können sie sich nicht leisten.
Die Corona-Krise hat daraus erwachsende ungleiche Teilhabechancen verstärkt. Ganz deutlich wurden die Unterschiede zwischen wohlhabenderen und weniger wohlhabenderen jungen Menschen im Jugendwohnen: die es sich Leisten können, haben einen eigenen Laptop und Computer, sind gut ausgestattet mit Software, Technik, um von ihrem Appartement aus arbeiten oder lernen zu können. Die, die weniger Geld haben, haben zwar alle ein Handy, aber keinen PC. Lernen und Arbeiten über das Handy ist kaum möglich. Das gefährdet die Bildungsabschlüsse. Die Berufsschulen haben ihren Unterricht und die Prüfungsvorbereitung auf digitale Angebote umgestellt. Ob und wie es den Jugendlichen möglich ist, daran teilzuhaben, wurde nicht abgefragt. Die Jugendlichen wurden seitens der Berufsschulen allein gelassen. Gleichzeitig haben öffentliche Bibliotheken und Internetcafé geschlossen. Es steht also keine Möglichkeit zur Verfügung technische Ausstattung zu nutzen, aber genau diese braucht man, um am Unterricht teilnehmen zu können. Das ist wie ein Teufelskreis.
Wir rechnen damit, dass viele ihre Prüfungen und letztendlich ihre Ausbildung nicht erfolgreich abschließen können.
Abhängig von der Branche konnte einige Auszubildende auch ins „Homeoffice“ wechseln. Aber das war natürlich auch nur für diejenigen sinnvoll, die über das Equipment verfügen.
Die schlechte finanzielle Situation, in der sich viele unserer Bewohner*innen befinden, verschärft es noch. Der Großteil unserer Jugendlichen sind junge Geflüchtete. Sie erhalten zwar eine Ausbildungsvergütung, sind aber dennoch häufig überschuldet. Unterschiedliche Gründe spielen dabei eine Rolle. Die Kostenheranziehung durch die Jugendämter ist einer. Anwaltskosten und Kosten, die im Zusammenhang mit der Beschaffung von Papieren stehen sind weitere. Zu Beginn ihrer Zeit in Deutschland benötigen die Jugendlichen anwaltschaftliche Hilfe beim Asylverfahren. Bei Fragen des Aufenthalts- und Bleiberechts während ihrer Berufsausbildung ist erneut anwaltschaftliche Unterstützung notwendig. Die Genehmigung, eine Ausbildung beginnen und absolvieren zu dürfen, machen die Behörden von einer Identitätsklärung abhängig. Hierzu müssen in den meisten Fällen Papiere und Urkunden im Heimatland besorgt werden. Daran sind viele Personen beteiligt. Und jeder lässt sich für seinen Dienst bezahlen. Hinzu kommen Kosten, die im direkten Zusammenhang mit der Flucht entstanden sind. Und als ob all diese finanziellen Belastungen nicht ausreichen würden, fühlen sich viele unserer Bewohner*innen verpflichtet ihre Familien zu unterstützen und schicken monatlich Geld in ihre Herkunftsländer.
Wie gestalten Sie momentan Ihren Kontakt zu den Jugendlichen?
Leonie Jacobi: Wir telefonieren mit den Jugendlichen, bevorzugt per Bildanruf. Für den regelmäßigen und alltäglichen Kontakt nutzen wir WhatsApp. Zum Teil haben wir uns in Gruppen zusammengeschlossen. Aber wir gehen auch viel mit den Jugendlichen draußen zu zweit spazieren. Das erfordert einen höheren Personaleinsatz.
Wie sieht Ihre Förderung und Beratung, etwa über digitale Tools, aus?
Leonie Jacobi: Aufgrund der oben beschriebenen Probleme beschränkt sich der Einsatz digitaler Anwendungen auf WhatsApp und Skype.
Zu verschiedenen Themen haben wir Videos gedreht und den Bewohner*innen per WhatsApp oder Link zugeschickt. Unsere Bewohner*innen-Struktur ist hinsichtlich der Herkunftsländer und des sozialen Status sehr heterogen. Nicht allen war klar, was ein Fieberthermometer ist und wie es funktioniert. Vor allem besaßen auch die wenigsten ein Fieberthermometer. Aber gerade für die Jugendlichen in Quarantäne bestand die Verpflichtung regelmäßig Fieber zu messen und das auch zu protokollieren. Auf Trägerkosten haben wir dann welche angeschafft – was gar nicht so leicht war. Der Markt war leergefegt. Und vorhandene Thermometer wurden nur zu überteuerten Preisen verkauft. Nachdem wir die Ausstattung erworben hatten, haben wir Videos gedreht, wie sie zu handhaben sind. Für viele in Deutschland lebende Menschen ist es eine Selbstverständlichkeit. Aber bei uns wusste ein Teil der Jugendlichen nichts mit einem Fieberthermometer anzufangen.
Auch zum Umgang mit Geld bzw. mit den Schulden, wie man günstig einen Haushalt führt, seine Einkäufe sinnvoll plant und wie man es schafft, auch am Monatsende noch Lebensmittel einkaufen zu können, bieten wir Hilfe und Tutorials an. Online geht Schuldnerberatung natürlich schlechter als in einem persönlichen Gespräch.
Was bräuchten die Jugendlichen jetzt?
Leonie Jacobi: Die jungen Menschen brauchen vor allen Begegnungsräume, tatsächliche Zusammenkünfte mit Menschen, sozusagen analoge Kontakte, und stabile Internetverbindungen mit ausreichendem Datenvolumen. Zusammen mit unserem Träger versuchen wir, bei uns im Haus für alle zugängliche Technik bereit zu stellen. Die baulichen Hürden, die das Haus mit sich bringt, stehen uns dabei leider im Weg.
Welche Unterstützung brauchen Sie als Einrichtung, um Jugendliche in dieser Situation besser begleiten zu können? Welche Rahmenbedingungen würden Sie sich in der aktuellen Situation von der Politik wünschen?
Leonie Jacobi: Die Mitarbeitenden leisten Unglaubliches. Wir haben ihre Arbeitszeiten zum Teil massiv verändert. Dazu haben wir bei ihnen eine Flexibilität vorausgesetzt, die in außerhalb der Sozialen Arbeit oder außerhalb des Gesundheitsbereichs selten zu finden ist. Bei uns war und ist niemand in Kurzarbeit. Wir waren die ganze über ein voll belegtes Haus. Mit Quarantänefällen und Fällen von Infizierten. Die Kolleginnen und Kollegen haben sich im Kontakt mit den jungen Menschen selber einer hohen Infektionsgefahr ausgesetzt. Hier hätte ich mir außer abendlichem Klatschen am Fenster andere Anerkennung für unsere Leute gewünscht. Auch kleine Gesten wären hilfreich. Mal ein Stück Kuchen oder eine Einladung zum Kaffee, etwas das die Motivation hochhält, wäre schön gewesen.
Der angekündigten Aufwertung Sozialer Arbeit müssen nun Taten folgen. Die Schieflage in der Bewertung und Vergütung von Arbeit ist gerade zu rücken. Die Corona-Krise hat nicht nur die Spaltung im Bildungsbereich verschärft. Wenn auf der einen Seite Menschen in gut bezahlten Jobs über Monate hinweg geschützt im Home-Office arbeiten und der „Stay at Home“-Parole folgen können und auf der anderen Seite Sozialarbeiter*innen, Beschäftigte im Gesundheitswesen oder Verkäufer*innen im Einzelhandel mit niedriger Bezahlung und oftmals befristeten Arbeitsverträgen den Alltagsbetrieb am Laufen halten, dann befinden wir uns in einer Schieflage.
Mit Blick auf die Zukunft braucht unser Haus dringend bauliche Veränderungen und eine bessere technische Ausstattung. Dazu gehört auch ein Computer/Arbeitsraum mit Drucker und stabiler Internetverbindung für Jugendliche, die keinen eigenen PC haben. Wir bräuchten auch Veränderungen, die es erlauben einen Quarantänebereich einzurichten, in dem sich junge Menschen über einen längeren Zeitraum aufhalten können, ohne durch die räumliche Enge psychischem Druck ausgesetzt zu sein.
Außerdem geht es auch um die Ausstattung bzw. den Zugang zu Schutzgütern und Hygieneartikeln wie Mund-Nasen-Masken, Desinfektionsmittel, Seife oder Toilettenpapier. Auch Vorratshaltung spielt eine Rolle. Im Grunde betriebt jede und jeder unserer Bewohner*innen in seinem kleinen Appartement einen eigenen Haushalt. Ihnen stehen nur geringe finanzielle Mittel zur Verfügung. Und der Platz ist begrenzt. Wenn dann Desinfektionsmittel oder Seife nur noch zu überteuerten Preisen oder gar nicht mehr eingekauft werden können, ist es für die Jugendlichen unmöglich geforderte Hygienestandards einhalten zu können. Eine Vorratshaltung, wie die Bundesregierung diese auch außerhalb von Krisenzeiten empfiehlt, ist sowohl aus Platzgründen nicht möglich als auch finanziell nicht für die Jugendlichen zu stemmen. Hier müssten wir als Einrichtung die räumlichen und finanziellen Möglichkeiten bekommen solche Löcher stopfen zu können.
Schlussendlich muss sich an der Unterstützung und Beratung durch die Kommune und das Gesundheitsamt etwas ändern. Selbst bei begründeten Verdachtsfällen auf eine Coronainfektion wurde das Jugendwohnheim allein gelassen. Dabei herrscht in einem Haus, in dem so viele Menschen zusammenwohnen, hohe Ansteckungsgefahr. Amtliche Test oder die Kontaktaufnahme zu Kontaktpersonen der infizierten Person haben nicht stattgefunden, auch nicht auf mehrmalige Nachfrage. Für die Zukunft ist da nachzubessern!
Das Interview führten Alissa Schreiber vom Verband der Kolpinghäuser und Silke Starke-Uekermann aus der Geschäftsstelle der BAG KJS.
Quelle: BAG KJS