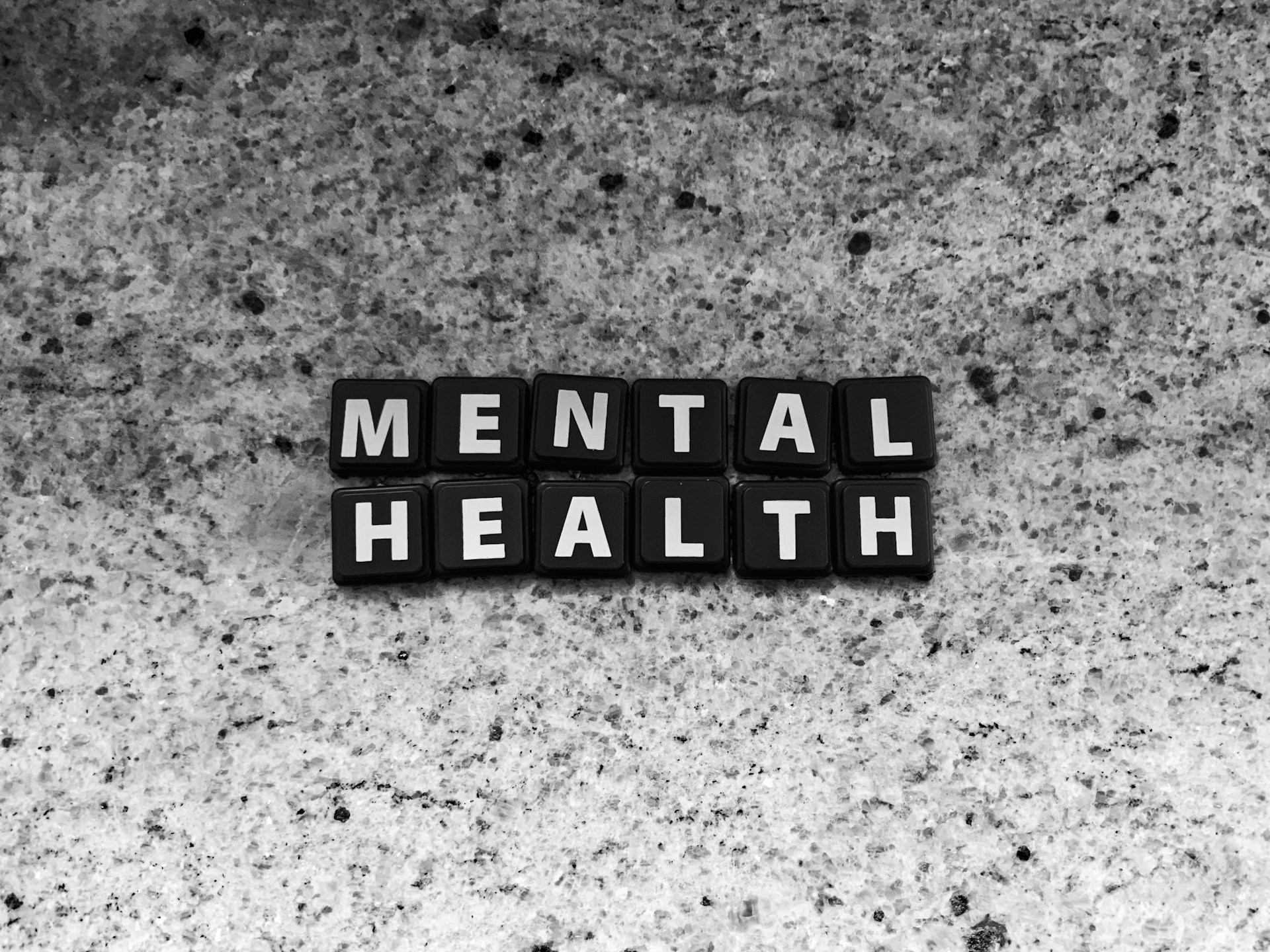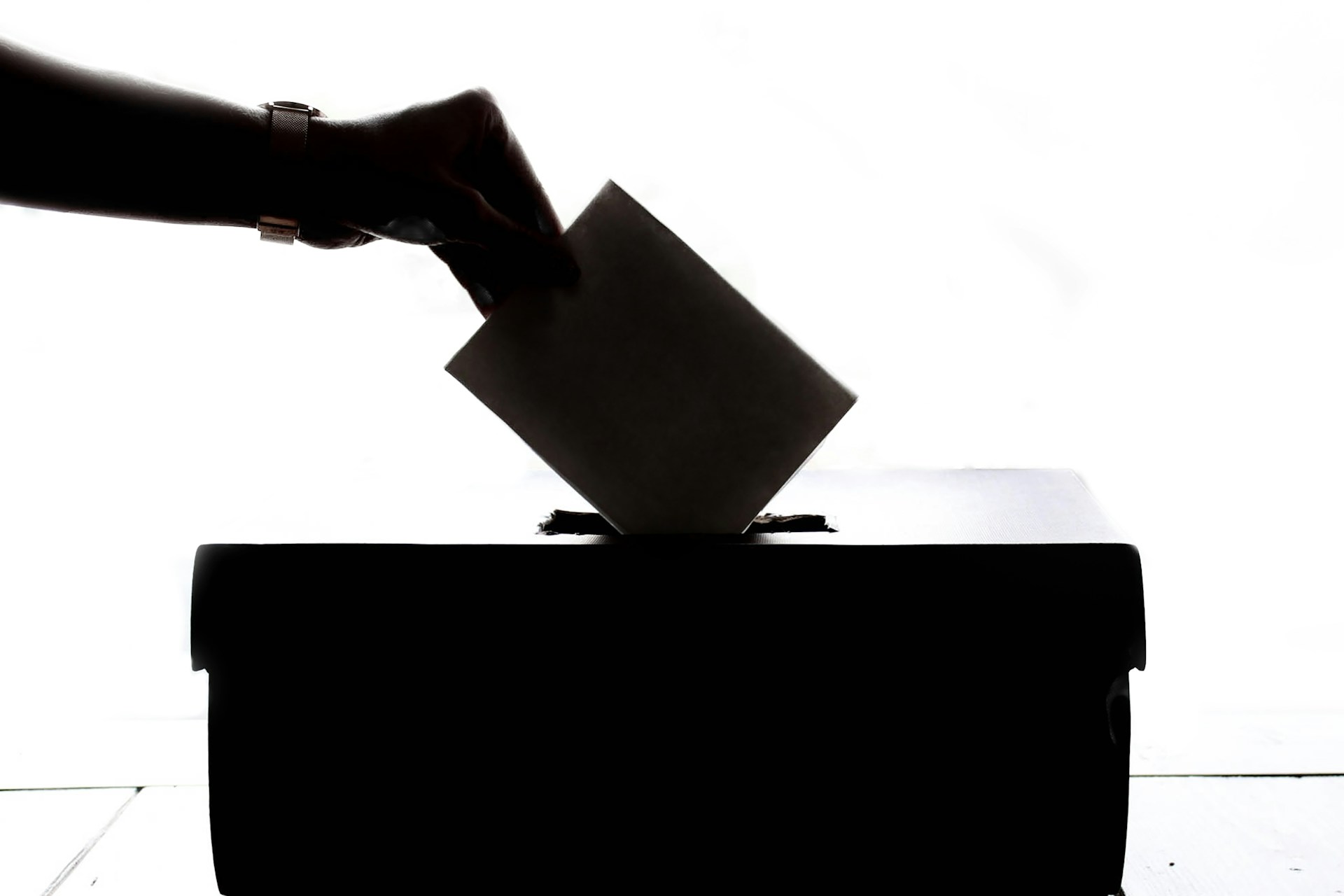OECD-VERÖFFENTLICHUNG ‚BILDUNG AUF EINEN BLICK‘ Die OECD legt mit ihrer jährlich erscheinenden Publikation Education at a Glance / Bildung auf einen Blick ein aktuelles Werk zu zentralen bildungspolitischen Fragen vor und beleuchtet diese aus einer internationalen Perspektive. Vor diesem Hintergrund hat sich Bildung auf einen Blick in den letzten Jahren zu einem wichtigen Bezugspunkt für die bildungspolitische Diskussion in Deutschland entwickelt. Der internationale Vergleich hilft bei der Identifizierung von Stärken und Schwächen der nationalen Bildungssysteme und ist somit auch eine wichtige Orientierungshilfe bei der Entwicklung von Reformstrategien. Auszüge aus den für Deutschland wichtigen Befunden aus Bildung auf einen Blick 2006: „… Bildung und Beschäftigung Bildung bereichert in vielerlei Hinsicht der ökonomische Aspekt ist nur einer unter vielen. Doch ist die persönliche Bildungsrendite wichtig, um Menschen zu weiteren Bildungsbemühungen zu motivieren. … Bildung ist in allen OECD-Staaten der sicherste Weg, um eine Teilhabe am Arbeitsleben zu gewährleisten. Der internationale Vergleich zeigt, dass in Deutschland die Qualifikation die Beschäftigungsquote stärker beeinflusst als in den meisten anderen OECD-Staaten. … Auffällig ist, dass die geschlechtsspezifischen Beschäftigungsquoten mit steigendem Bildungsniveau näher beieinander liegen. Besonders niedrig sind die Beschäftigungsquoten von gering qualifizierten Frauen. In Deutschland waren im Jahr 2004 lediglich 43 % der Frauen mit höchstens einem Abschluss der Sekundarstufe I erwerbstätig. Bei noch geringer qualifizierten Frauen lag der Wert bei 29 %. Bei den Männern betragen die entsprechenden Werte 62 % und 49 %. Die Wirtschaft ist gefordert, ihre Angebote im beruflichen Bereich auszuweiten. … Mathematikkompetenzen 15-Jähriger Schüler Bildung auf einen Blick referiert auch in diesem Jahr wieder Teilergebnisse von PISA 2003. Dabei ist der Blick besonders auf die mathematischen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler gerichtet, die Probleme haben, über die niedrigste Kompetenzstufe hinaus zu kommen. Mit einem Anteil von rund 22 % Schülern, die bei PISA 2003 höchstens die unterste Kompetenzstufe in Mathematik erreicht haben, liegt Deutschland international im Mittelfeld… Der Kompetenzzuwachs, den Deutschland insgesamt in Mathematik gegenüber PISA 2000 zeigen konnte, schlägt sich aber noch nicht durchgehend nieder. Auffällig ist bei den deutschen Ergebnissen, dass für Schülerinnen und Schüler mit schwächerer sozioökonomischer Herkunft das Risiko, zu den leistungsschwächsten Mathematikschülern zu gehören, erheblich höher ist als in den meisten anderen OECD-Staaten. Höher ist das diesbezügliche Risiko nur in Belgien und der Slowakischen Republik. Ausgeprägt ist in Deutschland – wie in Belgien, Japan, Luxemburg, Mexiko und der Slowakischen Republik – zudem das Phänomen, dass Schülerinnen und Schüler mit schwachen mathematischen Leistungen auch häufig schwache Leser sind. Mit einem Anteil von mehr als 20 % der 15-Jährigen, die bereits mindestens ein Schuljahr wiederholt haben, liegt Deutschland erheblich über dem OECD-Durchschnitt von 13 %. Unbefriedigend bleibt, dass in Deutschland der Erfolg beim Erwerb von mathematischer Kompetenz weit stärker als in vergleichbaren Staaten vom sozioökonomischen Hintergrund der Schüler geprägt ist. Um bei internationalen Kompetenzvergleichen einen Spitzenplatz belegen zu können, aber auch mit Blick auf die individuelle Chancengerechtigkeit muss in Deutschland der Einfluss des sozioökonomischen Hintergrundes auf die Lernergebnisse deutlich verringert werden. Seit der ersten PISA-Veröffentlichung hat die Kultusministerkonferenz einen Schwerpunkt der qualitätssichernden Maßnahmen und Reformen auf die wirksame Förderung bildungsbenachteiligter Kinder, insbesondere mit Migrationshintergrund gelegt. Erste Reformschritte sind eingeleitet worden. Erklärte Ziele der Länder sind insgesamt gute Leistungsergebnisse sowie eine Entkopplung von sozialer Herkunft und erreichter Kompetenz. Allerdings können nur langfristig angelegte und kontinuierlich fortgesetzte Maßnahmen zur individuellen Förderung und Unterstützung besonders von Schülerinnen und Schülern mit schulischen oder sozialen Problemen zu nachhaltigen Verbesserungen führen. … notwendiger Maßnahmen zählen eine frühe Förderung vor und während der Schulzeit, die differenzierte Förderung im Unterricht und außerhalb der Unterrichtszeit sowie der weitere Ausbau von Ganztagsangeboten. Eine zentrale Rolle kommt dabei aus Sicht der Kultusministerkonferenz der Unterrichtsentwicklung und der weiteren Professionalisierung der Lehrerinnen und Lehrer zu. Deshalb werden in den Ländern Projekte zur frühzeitigen Förderung von Migranten und sozial Benachteiligten sowie Fortbildungskonzeptionen und -materialien zur Unterrichtsentwicklung in den Bereichen Lesen und Mathematik entwickelt, ergänzt durch Konzepte und Materialien für Deutsch als Aufgabe aller Fächer. … Im Juni 2006 haben Bund und Länder den ersten gemeinsamen Bericht „Bildung in Deutschland“ vorgelegt. Mit den darin präsentierten Ergebnisse können Bund und Länder bildungspolitische Entscheidungen auf einer deutlich verbesserten Grundlage treffen. Die gemeinsame Bildungsberichterstattung wird kontinuierlich fortgeführt, so dass der nächste Bericht mit dem Schwerpunkt Übergänge zwischen Schule – Berufsbildung/Hochschulbildung – Arbeitsmarkt voraussichtlich im Herbst 2008 der Öffentlichkeit vorgestellt werden kann. “
http://www.bmbf.de/press/1871.php
Quelle: Pressemitteilung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung