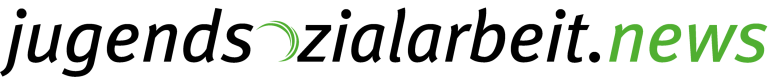Implikation des Inklusionsbegriffs für die Unterstützung Jugendlicher im Übergang
Auszüge aus einem der Hauptreferate der Fachtagung von Dr. Andreas Oehme – Universität Hildesheim:
„Inklusion als neues Paradigma
Der Begriff „Inklusion“ gilt seit einigen Jahren als neues Paradigma im Bereich der Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Eine inklusive Ausrichtung der professionellen Hilfen für Menschen mit Behinderung ist inzwischen auch mit der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen und ihrer deutschen Ratifizierung politisch bindend. Die Diskussion hierzu bewegt sich bisher allerdings weitgehend im Rahmen von Schule und bleibt fast durchgängig auf den Adressatenkreis der Menschen mit Behinderung beschränkt. Die wenigen Veröffentlichungen, die sich von hier aus mit den Übergängen in Arbeit befassen, scheinen oft die in der Benachteiligtenförderung üblichen Förderinstrumente als Schritt hin zum Inklusionsparadigma zu sehen. Davon kann allerdings nicht die Rede sein, wenn man einmal die Förderphilosophien und Förderpolitiken in der Benachteiligtenförderung aus der Perspektive des Inklusionsparadigmas kritisch betrachtet. … Dazu verhält sich auch die Art und Weise, in der der Bereich der Benachteiligtenförderung organisiert ist, sperrig zu einer auf Inklusion hin ausgerichteten professionellen Unterstützung. … Wie wären diese professionellen Angebote zu organisieren, um überhaupt so etwas wie eine inklusive Pädagogik des Übergangs zu ermöglichen?
Die Prozesse der sozialen und beruflichen Integration, die in dieses System eingegossen sind, lassen sich bildlich als Zugfahrt auf einem Gleissystem darstellen: Die Bildungsinstitutionen sind aus Perspektive der Menschen Streckenabschnitte, die sie zurückzulegen haben. An bestimmten Punkten – nämlich vor jedem Abschnitt, d.h. jeder Statuspassage – sind Weichen eingebaut, die je nach Leistungen … – in die eine oder andere Richtung gestellt werden. Diese Weichenstellungen sind zugleich auch Entscheidungen über die weitere berufliche Zukunft und den gesellschaftlichen Status. Denn die Schule ist hier natürlich nur Teil eines gesamten Ausbildungs- und Beschäftigungssystems, das sich im Ausbildungsmarkt und im Arbeitsmarkt fortsetzt. Da dieses Gleissystem eine bestimmte, in sich gegliederte Normalität der gesellschaftlichen Integration setzt, wirkt es nicht nur integrierend, sondern auch exkludierend. Diejenigen, die den Normalitätsstandards nicht entsprechen, fallen aus dem sogenannten Regelsystem heraus. In der Logik dieses Systems muss an den Menschen, die diesen nicht genügen, ebenfalls ein Status definiert werden: Sie sind entweder Benachteiligte oder Behinderte.
Statuszuweisung: Benachteiligte oder Behinderte
Dieser Prozess der Statuszuweisung ist nun in der Sonderpädagogik bzw. der Soziologie der Behinderung als eine soziale Konstruktion von Behinderung beschrieben worden. Aus dieser Perspektive ist man nicht behindert, sondern man wird behindert. So wird beispielsweise in Hinblick auf den Übergang von Schule in Beruf bei Schülerinnen und Schülern, die eine Förderschule besuchen oder an denen schon früher ein sonderpädagogischer Förderbedarf diagnostiziert wurde, in der Regel ein Gutachten durch den psychologischen Dienst der Arbeitsagentur erstellt. Dieses Gutachten ist meist die Grundlage für die Ansprüche auf Unterstützung, und damit auch für die Zuweisung zu speziellen Hilfemaßnahmen. In der herrschenden Logik wird dazu Behinderung in einem medizinischen Sinne am Individuum diagnostiziert. …
Zudem haben die Gutachter nicht nur das Individuum im Blick, sondern vor allem auch die institutionellen Förderangebote, in die der oder die zu Begutachtende aufzunehmen wäre. Dieses Angebot – in Verbindung mit den eingeschätzten Chancen auf dem Arbeitsmarkt – bestimmt die Diagnosen entscheidend mit. Zusätzlich wirken hier auch bildungs- und beschäftigungspolitische Ausrichtungen, die die Angebotslandschaft und die bevorzugte Zuweisungspraxis stark bestimmen. Behinderung wird dem Individuum also … zugeschrieben, weil das Bildungssystem und weil das ganze Hilfesystem es so verlangt.
…
Aufgrund dieser Mechanismen ist … ein Übergangssystem entstanden, das heute gemeinhin als Förderdschungel bezeichnet wird. Aus Perspektive der Adressaten und Professionellen stellt es sich in ober verwandter Bildlichkeit als Gleiswirrwarr dar. … Für jeden Problemfall wurde und wird fortlaufend ein neuer Maßnahmetypus konstruiert. Zugleich haben die Angebote als Teil eines Dienstleistungsmarktes eine Eigenlogik entwickelt, die vielfach gegen die Bedürfnisse der Adressaten steht. …
Der Idee nach soll jede institutionalisierte Hilfemaßnahme den individuellen Förderbedarf aufgreifen und auf eine berufliche Integration abzielen. Die wird hier wieder als institutionelle Integration verstanden – „Eingliederung“ entweder auf dem ersten Arbeitsmarkt oder in Folgemaßnahmen bis hin zur Werkstatt für behinderte Menschen. Das gesamte System folgt damit also – in unterschiedlichen Abstufungen – dem Grundsatz der „Integration durch Separation“…
Diese Vielfalt ist an sich nicht problematisch, aber sie ist derzeit in dem eben beschriebenen institutionell versäulten Übergang verortet. Das bedeutet, das eine Vielzahl von Akteuren sehr spezifische, institutionell verortete Angebote vorhält, die nun quasi nach Adressaten, heute meist „Kunden“ verlangen. Selbst wenn diese Angebote in ein sogenanntes „kohärentes Fördersystem“ gebracht werden, wie es heute angestrebt wird, stehen die Adressaten vor einem hoch differenzierten System, dass ihnen immer nur fragmentiert Unterstützung gewährt.
Inklusion anstelle von Integration
Diese Grundlogik der Separation in gesonderten Einrichtungen und in einem System hoch spezialisierter Hilfemaßnahmen ist nun seit einigen Jahren besonders von Seiten behinderter Menschen einer grundlegenden Kritik unterzogen worden. Mit dieser Kritik ist gleichzeitig der Inklusionsbegriff zu einem neuen Paradigma in der Sonderpädagogik – vor allem im Kontext von Schule – entwickelt worden, der meist in Absetzung zum Integrationsbegriff herausgearbeitet wird. … Im aktuellen Diskurs versteht man nun unter Integration im allgemeinen die Anpassung des Individuums an die institutionell geregelten Formen des Lernens, die als Normalität gelten. …
Gegen diese Integrationslogik wird nun eine Logik der Inklusion gesetzt: Diese erkennt einfach an, dass die Menschen verschieden sind, dass Heterogenität also ganz normal ist. Damit wird auch die binäre Unterscheidung und Zuordnung aufgehoben, so dass ein gemeinsames Lernen (hier wieder auf Schule bezogen) möglich wird. Dazu muss das Lernen natürlich individualisiert werden, d.h. jeder und jede hat Anspruch auf die eigene Art und Weise des Lernens und auf die benötigte Unterstützung. Damit kommt nun stärker die Gestaltung der Institution in den Blick, die den individuellen Bedürfnissen gerecht werden muss – und die daran arbeiten muss, behindernde Barrieren abzubauen, wie es der Index der Inklusion nennt.
…
Organisationskonzept unter Beteiligung der „Adressaten“
Die Verschiedenheit der Menschen gilt aus inklusiver Perspektive nun als Ausgangspunkt, als die eigentliche soziale Normalität, der auch die Bildungsinstitutionen und –systeme ohne Separation gerecht werden müssen. Partizipation thematisiert die Teilhabe, und zwar gerade auch den aktiven Part der Beteiligung und Mitbestimmung. Denn die Teilhabe bezieht sich ja nicht nur auf die Zugehörigkeit zu einer Institution, sondern gerade auch auf das Handeln, auf das sich Einbringen und das mitgestalten der eigenen Handlungskontexte. Damit lässt sich auch Inklusion stärker als Prozess beschreiben, als die interaktive Konstitution von sozialen Handlungskontexten und als Gestaltung von organisationalen Handlungsrahmen. Dieses begriffliche Gerüst gilt es zukünftig auf die entscheidenden Felder gesellschaftlicher Teilhabe zu beziehen: Es geht darum, Bildung und Beschäftigung so zu organisieren, dass durch das Handeln der Menschen – das lernen wie das arbeiten – inklusive Strukturen entstehen, d.h. soziale Handlungskontexte, die allen in ihrer Verschiedenheit eine ihren Bedürfnissen entsprechende soziale Teilhabe eröffnen. Dies lässt sich heute natürlich nicht nur auf Bildungseinrichtungen und Erwerbsarbeit beschränken, sondern reicht auch weit in die Zivilgesellschaft hinein.
…
Wir haben es also im Grunde mit einem Organisationskonzept zu tun, das nicht auf die Anpassung des Individuums, sondern auf die Gestaltung der organisationalen Handlungsrahmen unter Beteiligung der „Adressaten“ abzielt. Man kann zwar jemanden integrieren, aber man kann ihn nicht inkludieren, sondern nur Inklusion erzeugen. Der universale Anspruch des Konzepts erfordert zugleich, den gesamten Hilfebereich der Reha und Benachteiligtenförderung als ein Kontinuum zu organisieren und entsprechend die derzeitige Trennung in der Diskussion zu überwinden.
…
Dieses Handlungskonzept lässt sich nun nicht in einem institutionell versäulten Übergangssystem verwirklichen, sondern es erfordert eine flexible, regional abgestimmte Hilfe- bzw. Unterstützungsstruktur. Ein Lösungsvorschlag ist, multiprofessionelle Teams zu bilden, die sozialräumlich verortet sind und die flexibel Hilfe in der gesamten Spannbreite anbieten können, so dass sie den Bedarfslagen der Adressaten entspricht. – Die also offene Beratung, Begleitung, Berufsorientierung, Beschäftigung und Beschäftigungsentwicklung, Ausbildung bis hin zur finanziellen Hilfe im Repertoire haben. Diese Teams setzen sich im wesentlichen aus den Akteuren zusammen, die derzeit mit genau diesen Aufgaben an verschiedenen Orten in ihrer jeweils eigenen institutionellen Logik unkoordiniert am Adressaten arbeiten, um sie oder ihn in Arbeit zu integrieren: verschiedene Träger, die Arbeitsagentur und ihr psychologischer Dienst, der Grundsicherungsträger (in der Regel das Jobcenter), das Jugendamt. …“
Quelle: IN VIA; Universität Hildesheim; Universität Göttingen