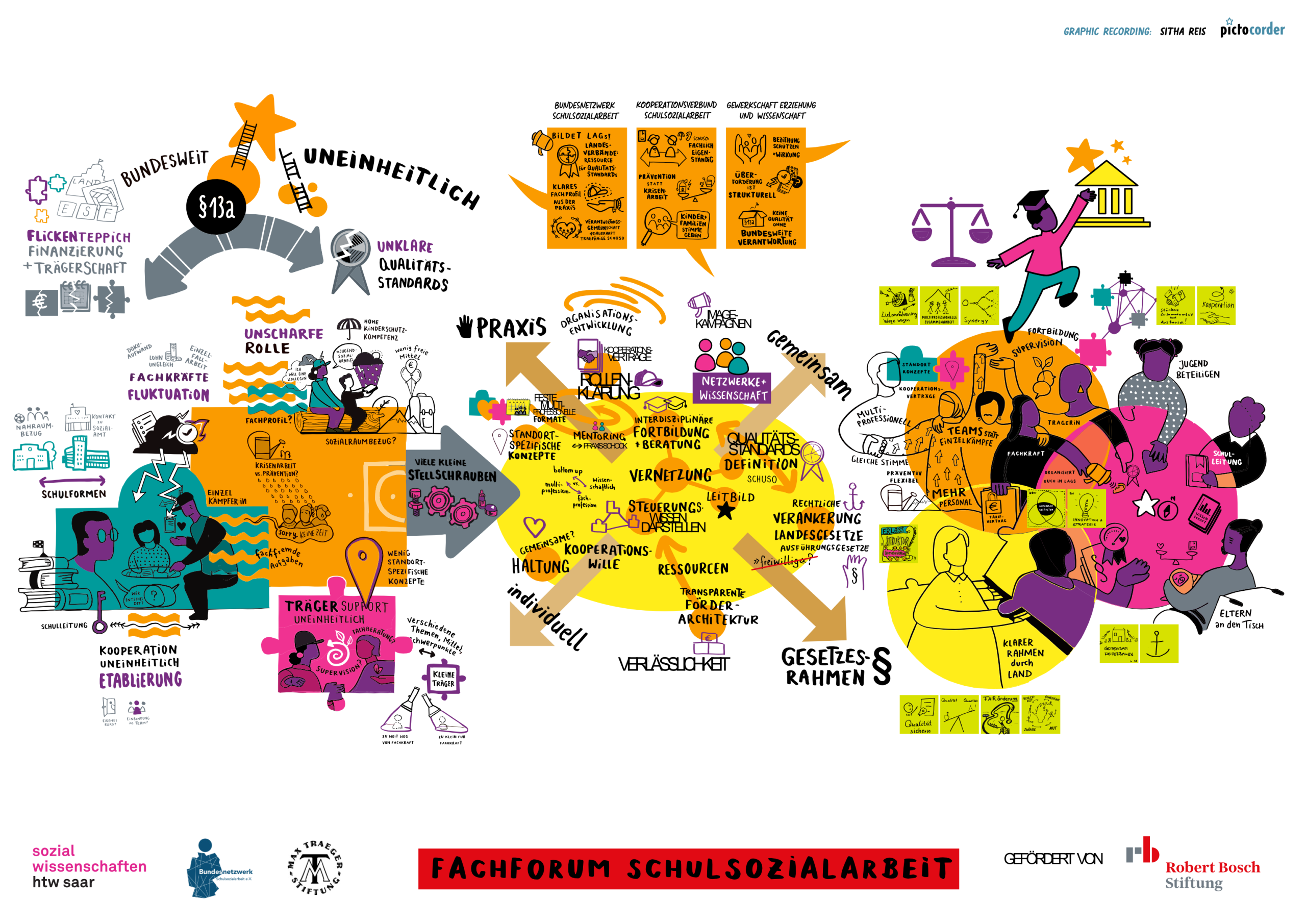Junge Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sind seltener politisch aktiv (11 %) als Gleichaltrige ohne Zuwanderungsgeschichte (40 %). Das belegen die Daten der aktuellen Studie des wissenschaftlichen Stabs des Sachverständigenrats für Integration und Migration (SVR), die die Teilhabechancen junger migrantisch wahrgenommener Menschen zwischen 15 und 35 Jahren untersucht hat. Mithilfe qualitativer Interviews wurden die Partizipationsmöglichkeiten sowie -hürden als auch Gelingensbedingungen der politischen Teilhabe von jungen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in Deutschland identifiziert und analysiert.
Laut dem Statistischen Bundesamt hatten im Jahr 2023 etwa 30 % der Bevölkerung in Deutschland einen Migrationshintergrund – knapp die Hälfte davon besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft. Wenngleich der Anteil der Bundestagsabgeordneten mit Zuwanderungsgeschichte über die letzten Wahlperioden gestiegen ist und derzeit bei 11,6 % liegt, wird die Vielfalt der Bevölkerung in der politischen Repräsentation weiterhin nicht entsprechend abgebildet. „Aus integrationspolitischer Sicht ist das problematisch, da Teilhabe politische Zugehörigkeit symbolisiert und die Identifikation mit dem Gemeinwesen und damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken kann“, sagt Dr. Nora Storz, Autorin der Studie und Mitarbeiterin im wissenschaftlichen Stab des SVR.
Bisweilen herrscht oftmals die Annahme vor, dass Jugendliche politisch weniger interessiert oder motiviert seien, sich zu beteiligen. Diese These wird jedoch durch Studien, wie beispielsweise die Shell-Jugendstudie 2024, widerlegt. Die Studien verweisen auf ein durchaus stabil gebliebenes bzw. teilweise sogar gestiegenes politisches Interesse junger Menschen. Im Vergleich zu älteren Menschen würden jüngere jedoch andere Formen der politischen Beteiligung und Partizipation bevorzugen und auch nutzen, wie an Demonstrationen oder Petitionen teilzunehmen, statt einer Partei beizutreten, merken die Autor*innen der SVR-Studie an. Es brauche daher ein besseres Verständnis der unterschiedlichen Ressourcen und Beteiligungsformen der verschiedenen Altersgruppen.
Politische Teilhabe und Politikverständnis
Eine wichtige Grundvoraussetzung für politische Partizipation ist laut den Studienherausgeber*innen ein Verständnis davon, was Politik ausmacht, mit dem eigenen Leben zu tun hat und wie sie mitgestaltet werden kann. Deutliche Unterschiede beim Politikverständnis zeigten sich zwischen den politisch aktiven und den politisch nicht-aktiven Befragten. Während Erstere Politik auch als Teilhabe und Mitgestalten verstünden sowie die Auffassung vertraten, dass der Alltag eines jeden Menschen politisch sei, sei dieses Bewusstsein bei Nichtaktiven deutlich geringer ausgeprägt. Politisch Nichtaktive verstünden unter Politik oftmals eher abstraktere und weniger nahbare Prozesse, die häufig mit Gesetzen, Regeln und Macht einhergingen. Die Motivationsgründe für die Partizipation der politisch Aktiven seien dabei vielfältig. Eine gesteigerte Bereitschaft, sich zu engagieren, zeigten die Befragten jedoch bei Themen, die sie selbst betrafen und somit eine Relevanz für viele Bereiche des täglichen Lebens hatten.
Hemmnisse und Motivationsfaktoren für politische Partizipation
Drei Hinderungsgründe für politische Partizipation von migrantisch wahrgenommenen Menschen wurden laut der SVR-Studie besonders oft genannt: fehlende Kontakte und Ansprechpersonen, fehlende Repräsentant*innen und Vorbilder sowie die Angst vor Diskriminierung durch politisches Engagement.
„Die Befragten fordern daher, das Wissen darüber, wie und wo man sich politisch beteiligen kann und was Politik ist, auch über zielgruppengerechte Kommunikationswege zu verbreiten. Denn mangelndes Wissen über zugängliche Partizipationsmöglichkeiten erschwert Teilhabe insbesondere dann, wenn das Interesse an Partizipation nicht groß ist oder davon ausgegangen wird, dass eigenes politisches Engagement ohnehin nichts bewirken könne“, merken die Studienherausgeber*innen an. Des Weiteren wurde von den Befragten der Wunsch geäußert, inklusivere und einfachere Sprache zu verwenden, sowie nach einer höheren Sichtbarkeit und Repräsentation der eigenen Gruppe. Dies hätte aus Sicht vieler Befragter eine Vorbildfunktion und würde das Gefühl von Zugehörigkeit in Bezug auf Politik stärken. Etwa die Hälfte der politisch Aktiven gab an, dass eine unzureichende Repräsentation der eigenen Gruppe sich negativ auf die Motivation, sich politisch zu engagieren, auswirken könne. Einige der Befragten bemängelten auch die Unterrepräsentation von Frauen oder Personen aus bestimmten sozialen Schichten, und forderten daher eine bessere Abbildung der gesamtgesellschaftlichen Vielfalt in der Politik.
Erfahrungen mit Rassismus und Diskriminierung
Viele der Befragten mit Zuwanderungsgeschichte äußerten das Gefühl, die Politik habe sie vergessen. Einige von ihnen verwiesen explizit auf Erfahrungen mit Diskriminierung und Rassismus. Diese Erfahrungen stellten für einige ein Hindernis, für andere hingegen eine Motivation für politisches Engagement im Allgemeinen und gegen Rassismus oder die Gefahr eines Rechtsrucks in der Politik im Besonderen dar. Laut Studie müsse diese Motivation jedoch auf einem starken Gefühl der Selbstwirksamkeit beruhen, d. h. auf der Überzeugung, durch eigenes Handeln etwas gegen Rassismus bewirken zu können. Denn Erfahrungen mit Rassismus könnten auch während des Engagements zu Frust oder zu einem geringeren Vertrauen in die Politik führen. Misstrauen gegenüber der Politik wurde hingegen eher von den politisch Nichtaktiven geäußert.
„Aus diesen Frustrationen und Erfahrungen heraus wird ein Bedarf an bestimmten Organisationsformen, Strukturen und Aktivitäten abgeleitet, in denen sich ausschließlich oder mehrheitlich (junge) Menschen mit Zuwanderungsgeschichte politisch beteiligen und sich entsprechend sicher und wohlfühlen, ihre Meinungen und Erfahrungen mitzuteilen“, so die Autor*innen der Studie. „In den Interviews wird der Wunsch nach sogenannten Safe(r) Spaces deutlich, sicheren Orten, an denen ein Austausch über (Diskriminierungs-)Erfahrungen jenseits der Alltagswelt stattfinden kann.“
Wege für mehr politische Teilhabe
Um Teilhabe und die Partizipationsbereitschaft junger Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zu verbessern, brauche es politische Bildungsarbeit, Vorbilder in der Politik, Antirassismus- und Antidiskriminierungsarbeit sowie mehr Gelegenheitsstrukturen. Politischer Bildung komme dabei eine wichtige Rolle zu, da Wissen über Beteiligungsmöglichkeiten ausschlaggebend für politisches Engagement sei. Durch sie könne auch politische Selbstwirksamkeit erzeugt und Werte und Normen vermittelt werden, die zur Teilhabe motivieren. „Die qualitativen Interviews verdeutlichen, dass es eine wichtige Aufgabe der politischen Bildung ist, Lernenden gute Kenntnisse über politische Prozesse und konkrete Partizipationsmöglichkeiten sowie über die Themenvielfalt der Politik zu vermitteln und dabei auch einen Bezug zur Lebenswelt der Lernenden herzustellen, der die Bedeutung politischer Partizipation verdeutlicht“, stellen die Herausgeber*innen der Studie heraus.
Über die Studie
Die Studie ist Teil des Projekts YoungUP!, das vom Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat (BZI) durchgeführt und von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration und zugleich Beauftragten der Bundesregierung für Antirassismus gefördert wird. Das Ziel von YoungUP! ist es, junge BIPoC zwischen 17 und 35 Jahren zu politischer Teilhabe zu ermutigen, sie dafür zu begeistern und zu empowern sowie ihre politischen Teilhabechancen zu stärken.
Ziel der Studie ist es, sowohl den aktuellen Stand der politischen Partizipation junger migrantisch wahrgenommener Menschen in Deutschland als auch die Gründe für eine geringere politische Partizipation zu analysieren. Zudem soll sie Fördermöglichkeiten für eine stärkere politische Partizipation aufzeigen.
Autorin: Mareike Klemz