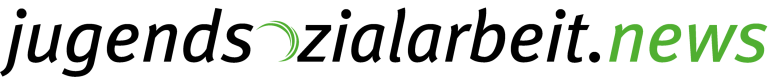Das Wissenschaftszentrum Berlin belegt mit seiner neuen Studie: Wo Eltern das letzte Wort haben, kommen noch weniger Arbeiterkinder aufs Gymnasium. Wenn Eltern bestimmen dürfen, welche weiterführende Schule ihr Grundschulkind besuchen soll, verschärft dies die soziale Ungleichheit der Bildungskarrieren. Ohnehin haben Kinder aus sozial höher gestellten Elternhäusern eine bis zu fünfmal höhere Chance, das Gymnasium zu besuchen, als Arbeiterkinder. Die sogenannte Freigabe des Elternwillens erhöht die Selektivität des Schulsystems noch. Auch Prüfungen oder die Einschätzung durch Lehrer werden kritisch gesehen. Ein sinnvolles Gegenmittel gegen die soziale Ungleichheit der Schulkarrieren ist die Aufgliederung nach Schulformen zu einem späteren Zeitpunkt. Längeres gemeinsames Lernen gebe Kindern aus sozial benachteiligten Familien die Möglichkeit, trotz ungünstiger Voraussetzungen im Wissens- und Leistungsstand aufzuholen und so die Voraussetzungen für einen Gymnasialbesuch zu erlangen.
Auszüge aus der Analyse „Soziale Spaltung am Ende der Grundschule“ von Marcel Helbig und Cornelia Gresch aus dem Wissenschaftszentrum Berlin:
Gymnasiale Laufbahn für Kinder aus gut situierten Familien fünfmal wahrscheinlicher als für Arbeiterkinder
„Die Chance, das Gymnasium zu besuchen, hängt in Deutschland immer noch in hohem Maße von der sozialen Schicht ab, aus der ein Kind kommt: Selbst bei gleichen schulischen Kompetenzen ist die Wahrscheinlichkeit einer gymnasialen Laufbahn bei Schülerinnen und Schülern aus besser situierten Familien knapp fünfmal höher als bei Kindern aus Arbeiterfamilien.
Für die schlechteren Bildungschancen von Arbeiterkindern gibt es zwei Gründe: Wer aus einer Arbeiterfamilie kommt, hat im Durchschnitt geringere schulische Kompetenzen als Kinder aus höheren Schichten; die Wissenschaft spricht hier von primären Herkunftseffekten. Zum anderen streben bessergestellte Eltern deutlich häufiger das Gymnasium und das damit verbundene Abitur für ihre Kinder an; dies sind sogenannte sekundäre Herkunftseffekte.
Inwieweit die Eltern aus höheren Schichten aber diese höher zielenden Schulwünsche (…) auch umsetzen können, hängt unter anderem von den schulrechtlichen Gegebenheiten ab. Zum Ende der Grundschulzeit sprechen in allen Bundesländern die Schulen eine Empfehlung für die weiterführenden Schulen aus. In einigen Bundesländern ist diese Empfehlung bindend, in anderen haben die Eltern das letzte Wort. Dieser „freie Elternwille“ ist eine umstrittene und oft diskutierte schulrechtliche Regelung. Welche Konsequenzen hat das freie Elternwahlrecht für soziale Ungleichheiten beim Gymnasialbesuch? (…)
Elternwille und soziale Ungleichheit
(…) Die Freigabe des Elternwillens führt dazu, dass bildungsorientierte Familien ihre Kinder häufiger aufs Gymnasium schicken. Der Blick auf Migrantenfamilien zeigt allerdings, dass hohe Bildungsaspirationen allein nicht ausreichen: Das starke Gewicht des Elternwillens erhöht die Gymnasialwahrscheinlichkeit nur in Familien, bei denen entweder positive Erfahrungswerte, beispielsweise durch die erfolgreiche Wegbereitung durch ältere Geschwister, oder aber ein hoher Sozialstatus das Erreichen der hoch gesteckten Bildungsziele nahelegen.
Die Frage nach dem Einfluss des Elternwillens auf die Schulkarriere von Kindern ist kein schulrechtliches Detail, sondern ein für viele Familien zentrales Element von Bildungspolitik. (…) Wenn man sich, wie in Deutschland, für ein vertikal gestuftes Schulsystem entscheidet, muss der Übergang auf die verschiedenen Schulformen nach einem leistungsbasierten Verteilungsschlüssel vorgenommen werden. Wenn der Elternwille ein Teil dieses Verteilungsschlüssels ist, führt dies dazu, dass soziale Ungleichheit beim Gymnasialübergang verstärkt wird. In noch stärkerem Maße setzen sich dann nämlich Schülerinnen und Schüler durch, deren Eltern hohe Bildungsaspirationen haben und zudem über die status- oder erfahrungsbedingte Sicherheit verfügen, ihre Kinder in schulischen Belangen fördern zu können. Im Gegensatz dazu kann eine rein bindende Grundschulempfehlung tatsächlich zu einem Leistungsdruck für die Kinder seitens ihrer bildungsorientierten Eltern führen.“
Mehr Zeit für den Ausgleich von Benachteiligungen würde helfen – Aufgliederung nicht schon nach der 4. Klasse
„Die Alternativen dazu sehen allerdings auch nicht besser aus. Würde man den Weg zurück zu Aufnahmeprüfungen wie in den 1960er Jahren gehen, würde das den Druck auf Kinder mit bildungsorientierten Eltern ebenfalls enorm erhöhen. Zudem würden Leistungen in der Grundschule nicht mehr entsprechend gewürdigt. Aspekte wie Motivation und Leistungsbereitschaft, die auch für den späteren Gymnasialerfolg wichtig sind und die sich in den Grundschulnoten widerspiegeln, kämen dann nicht mehr zur Geltung.
So führt auch diese Debatte zu einer Diskussion, die prägend für das deutsche Bildungssystem ist: Wenn man sich, wie in den meisten Bundesländern, dafür entscheidet, Schülerinnen und Schüler im Alter von zehn Jahren auf die verschiedenen Schulformen aufzuteilen, wird soziale Ungleichheit gefördert. Die Aufwertung des Elternwillens verstärkt diese Ungleichheit. Das einzige wirksame Gegenmittel, das wir sehen, ist die Aufgliederung zu einem späteren Zeitpunkt. So können zum einen herkunftsbedingte Leistungsunterschiede von Schülerinnen und Schülern aus sozial benachteiligten Elternhäusern besser ausgeglichen werden, zum anderen können auch die Interessen der Kinder selbst in stärkerem Maße in die Schulwahl einbezogen werden.“
Quelle: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung; bildungsklick.de