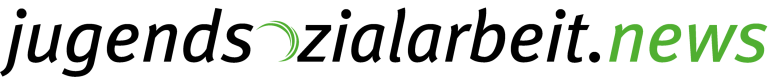Ausbildungsfähigkeit: Vom Begriffsdschungel zur Realität jugendlicher Lebenswelten Auszüge aus einer Auseinandersetzung mit dem Begriff Ausbildungsfähigkeit und auch vielen anderen aus dem Bereich Jugend und Arbeit von Steffen Großkopf aus der Zeitschrift ‚Sozialextra‘, Ausgabe Mai 2005 „…Ursprünglich wurde der Begriff im Zusammenhang mit der Ausbilder-Eignungsverordnung (AEVO) aus dem Jahre 1969 gebraucht und meinte die zertifizierte (.) Fähigkeit eines ausbildenden Betriebs. Mit der Zeit begann der Begriff ein Doppelleben zu führen, wobei sich seine Referenz zunehmend zu den Jugendlichen verschob. Kein Wunder: Die Diskussion um schlechte SchülerInnen gehört zur abendländischen Tradition auf Bildungsdebatten ist Verlass. Tradition Schon vor 20 Jahren wurde von Jugendlichen behauptet, sie würden durch mangelhaftes Berufswahlverhalten die Ausbildungsmisere mitverursachen und wären kognitiv wie emotional überfordert. Heute beruft sich die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) auf Betriebsbefragungen und beanstandet in ihrer Broschüre „Option für die Jugend“ Mängel bei SchulabgängerInnen in den Kulturtechniken (Schreib- und Rechenfähigkeit, Texterstellung und -verständnis) und Schlüsselqualifikationen (Selbstständigkeit, Engagement, Zuverlässigkeit, Lernwilligkeit, Selbstmanagement usw.). Ihr Befund lautet: „Ungenügende Ausbildungsfähigkeit“, denn ein Großteil der Unternehmen kann aufgrund der defizitären SchulabgängerInnen vorhandene Aus-bildungsstellen nicht besetzen … Zynismus schwingt hier schon mit, denn damals wie heute war und ist die Lehrstellensituation prekär. Konjunkturelle Gründe sind es wohl, die die Kritik an den Jugendlichen auslösen. Eine solche Annahme stützt auch das „Fast- Zustandekommen“ der von Gewerkschaften schon lange geforderten Umlagefinanzierung beziehungsweise das Endprodukt „Ausbildungspakt“ und des-sen „Erfolg“. Dieser schreibt zugleich den Referenzwechsel von „Ausbildungsfähigkeit“ fest, denn seit 1996 gilt eine entschärfte AEVO und seit dem 01.08.2003 ist sie komplett ausgesetzt.1 Während Politik und Wirtschaft massiv auf Bildungsstandards in der Schule insistieren, destandardisieren sie selbst zunehmend die Ausbildung. Mängel in den Betrieben Relativiert werden müssen daher auch einige andere Argumente in der Debatte um die „Ausbildungsfähigkeit“. So zum Beispiel das tendenziell zunehmende Prüfungsversagen der Auszubildenden im Handwerk: Längst ist bekannt, dass die Gründe für „Ausbildungsabbrüche“ und Prüfungsversagen komplex sind, neben den schulischen Leistungen spielt die Betreuung durch AusbilderInnen und BerufsschullehrerInnen eine wichtige Rolle. Die „Ausbildungsfähigkeit“ der Betriebe weist hier klare Mängel auf (vgl. BIBB 2002 HECKER 2000). So haben Industrie- und Handelskammern/ Verbände es versäumt, AusbilderInnen hinreichend zu qualifizieren. Eine Kontrolle der Ausbildungsfähigkeit von Betrieben fehlt völlig oder geschieht nur wenig effektiv, harsche Kritik gilt den PrüferInnen. Polemik Vermutlich geht es jedoch bei der Kritik an den Jugendlichen um Polemik, die von einer tatsächlichen Defizitbearbeitung wegführen soll. „Ausbildungsfähigkeit“ könnte ein Legitimationsschlagwort sein wie „demografische Entwicklung“ oder „Globalisierung“. Mit dem Begriff betreibt die Wirtschaft Öffentlichkeitsarbeit, um ihre Interessen durchzusetzen in Ausbildungsfragen war das schon öfters der Fall…. So sollen denn unter dem Deckmäntelchen der „Erfordernisse aus der Praxis“ wirtschaftsdienliche Einstellungen und Verhaltens-weisen vermittelt werden. Neben aller begrifflichen Unklarheit sind auch die betrieblichen Einstellungstests, auf denen die Aussagen basieren, wissenschaftlich ziemlich fragwürdig. Sinnvoll wäre zwar eine verbesserte BewerberInnenauswahl, die nicht nur nach der formal höheren Qualifikation fragt, doch wäre das Problem damit noch lange nicht erfasst: Die – vermutlich nur vorgeblich freien – Stellen würden wohl besetzt werden, wenn nicht die aufgrund der Lehrstellenknappheit angehobenen Ansprüche dies verhindert hätten (vgl. u. a. POLLMANN 1993, S. 62). Dabei trifft der Lehrstellenmangel Mädchen doppelt so häufig wie Jungen (vgl. GANATO/SCHITTENHELM 2004 SCHWEIKERT 1999, S. 78 f.) – sind sie weniger „ausbildungsfähig“? Trotz besserer Abschlüsse finden Mädchen schlechter Zugang zum Ausbildungsmarkt, einmal mehr hängt ihre Einmündung in Ausbildungsberufe von den Bedingungen am Arbeitsmarkt ab, wenn sie nicht durch Tests verhindert wird, die Männer für Männerberufe bevorzugen. In der Debatte um „Ausbildungsfähigkeit“ schlagen sich neue „governance- Strategien“ nieder, mit der Betriebe ihre Ausbildung kurzfristig und kostengünstig statt bedarfsorientiert organisieren. Sie bilden dann in „Basisberufen“ relativ breit aus, um die Kostenentwicklung zu steuern. Das Interesse an fachübergreifenden Kompetenzen belegt dies, wobei die Unternehmen zugleich zunehmend auf extern, durch Fach- und Hochschulen ausgebildete Arbeitskräfte zurückgreifen (vgl. BAETHGE 1998). Dem entspricht die Absicht, niedrig qualifizierende zweijährige Ausbildungen zu etablieren, welche Jugendlichen keinerlei Zukunftschancen eröffnen (vgl. SCHÖNIG/FARHAUER 2004), sowie die klare Tendenz zur Verstaatli-chung der Berufsausbildung. Es könnte sein, dass die „ausbildungsfähigen“ Jugendlichen sich gar nicht bei den Betrieben bewerben, sondern weiterführende Schulen oder andere Aus-bildungsformen bevorzugen. Die Behauptung von der fehlenden Ausbildungsfähigkeit blendet aus, dass Berufe völlig verschiedene Anforderungen an Jugendliche stellen. Leistungen in Rechen- und Rechtschreibtests stehen beispielsweise in keinem bedeutenden Zusammenhang mit dem Ausbildungserfolg, die Prognosefähigkeit der Tests ist eher gering, da die erfassten Merkmale nicht im unterstellten Maße erfolgsrelevant sind. Letztlich ist Eignung nur in Bezug auf einen konkreten Beruf definierbar. Das trifft auch für die sozialen Kompetenzen zu, bei denen auf den ersten Blick mehr Konsens zu bestehen scheint doch auch dieser Begriff ist umstritten (vgl. HOF 2002). Unbestritten erhöhen sich aufgrund des technischen und sozialen Wandels auch die Anforderungen der Berufe selbst und damit auch die personellen Leistungsvoraussetzungen. Das führt jedoch zum systematischen Ausschluss von SchülerInnen bildungsferner sozialer Schichten und damit zum Ausschluss potenziell „ausbildungsfähiger“ Jugendlicher. Wie kompliziert die Angelegenheit ist, belegt auch das Nord-Süd-Gefälle der „kognitiven Leistungen“ bundesdeutscher Jugendlicher. Sie hängen offensichtlich mit der Wirtschaftskraft der Regionen und den mit dieser verbundenen Defiziten bei Bildungsinvestitionen zusammen (vgl. EBENBRETT/HANSEN/PUZICHA 2003). Des- oder Orientierung? Gerne wird als Element der „Ausbildungsfähigkeit“ auch die „Berufsorientierung“ bezeichnet. So kritisiert der BDA, dass Jugendliche ihre Ausbildung aufgrund mangelnder „Berufsorientierung“ vielfach wieder abbrechen. Nur: Solche Vertragslösungen finden meist im ersten Ausbildungsjahr statt und stehen selten für einen endgültigen Ausbi-dungsabbruch, vielmehr wird der Beruf/ Betrieb gewechselt (vgl. BMBF 2004, S. 176 f.). Die Entscheidungen treffen die J-gendlichen nicht leichtfertig, häufig genug handelt es sich um die Lösung eines Problems zwischen Lehrling und AusbilderIn (vgl. HECKER 2000). Deshalb sind eher kleine und mittlere Betriebe betroffen, da hier keine Versetzungen möglich sind. In Großbetrieben kommt es demge genüber seltener zu Vertragslösungen, da sie relativ sichere Arbeitsplätze, höhere Sozialleistungen und bessere Übernahmechancen bieten. Spricht dies für eine mangelnde Berufsorientierung Jugendlicher? Wohl kaum. Denn sie agieren auch altersbedingt durchaus kompetent in ihrer Situation, nämlich eher modern, weil autonom. Vor allem: Sie sind – auch aufgrund besserer Bildung – kritischer und haben gelernt, was der BDA „Selbstmanagement“ nennt. Überraschen sollte das nicht in einer unübersichtlich gewordenen Welt, mehr schon verwundert die Klage der UnternehmerInnen. Denn es scheint schon arg paradox, Menschen Diskontinuitäten und Flexibilität zuzumuten, aber mit der resultierenden Dialektik nicht umgehen zu können. Die Forderung nach einer „stabilen Persönlichkeit“ als Teil der „Ausbildungsfähigkeit“ (THIES 2001) erweist sich spätestens hier als Ideologie – wenn nicht als Groteske angesichts der zugleich erhobenen Forderung, Jugendliche sollten hinsichtlich der „Berufswahlsituation“ gefälligst flexibel sein. ‚Ausbildungsfähigkeit“ Welchen Begriff hätten sie denn gerne? Inzwischen wurde der Begriff „Ausbildungsfähigkeit“ sogar im DTV-Wörterbuch der Pädagogik (2000) aufgenommen, nachdem er noch 1995 dort nicht vorkam. Er wird als Fähigkeit von SchulabgängerInnen definiert: „Bestimmt wird die Ausbildungsfähigkeit vor allem durch die Anforderungen der Ausbildungsrahmenpläne und den Erwartungen der Betriebe, wesentlich ist auch die Mitwirkung an der Berufswahl. Das Anspruchsniveau an die Ausbildungsfähigkeit konkretisiert sich anhand des Angebots-Nachfrageverhältnisses“ (ebd., S. 53 f.). Doch jenseits solcher Bestimmungen ist der Begriff inhaltlich unklar und analytisch wertlos. An anderer Stelle wird sogar von „Ausbildungsreife“ gesprochen – Ausbildungsfähigkeit und Ausbildungsreife sind offenbar Synonyme, die letztendlich im Begriff der Allgemeinbildung verschmelzen. Die Tradition lässt grü-ßen. Interessanterweise findet sich aber „Ausbildungsreife“ nicht im Wörterbuch. Dafür taucht der Begriff der „Berufsorientierung“ auf, wobei dieser die Aufgabe von Institutionen beschreibt. Seine subjektive Dimension wird hingegen im Wörterbuch als „Berufswahlkompetenz“ bezeichnet. Doch nicht genug der Verwirrung. Famulla sieht in der „Berufsorientierung“ mehr als „Berufswahlfähigkeit“. Dies begründet sich darin, „dass mit den ,alten’ Begriffen wie ,Berufswahlfähigkeit’, Ausbildungsfähigkeit’ und ,Beschäftigungsfähigkeit’ offenkundig das Verhältnis von geänderten subjektiven Interessenlagen der Jugendlichen bei der Berufswahl einerseits und den neuen Herausforderungen der Arbeitswelt andererseits nicht mehr angemessen bezeichnet werden kann“ (FAMULLA 2001, S. 10). Entsprechend birgt „Ausbildungsfähigkeit“ die Gefahr, das Wollen der Jugendlichen unbeachtet zu lassen und Qualifikationsanforderungen einseitig aus Sicht des Beschäftigungssystems zu definieren. „Berufswahlfähigkeit“ hingegen steht für die rationale Entscheidung, für einen planbaren Lebenslauf durch Kenntnis der eigenen Fähigkeiten und Wahl eines adäquaten Lebensberufs – das war jedoch allenfalls noch in den 1970er -Jahren möglich. „Berufsorientierung“ bezeichnet Famulla als Suche in der Übergangsphase von der Schule ins Arbeitsleben, die „Berufswahl“ hingegen sei ein länger andauernder und eigenverantwortlicher Prozess, der mit der Schullaufbahnentscheidung beginne (ebd., S. 11). Allerdings scheint die Rede von der „Eigenverantwortung“ fragwürdig, denn gerade die Schullaufbahn liegt kaum in der Entscheidungsgewalt des Kindes. Die Eltern bleiben übrigens auch der bedeutendste Faktor für die Berufswahl, selbst wenn ihnen meistens die Sachkompetenz fehlt. Mit wachsender Autonomie versuchen die Jugendlichen, ein Maximum weiterer Optionen zu sichern (vgl. SCHOBER/ GAWOREK 1996). Entsprechend stellt für ein Viertel der BerufsschülerInnen die Ausbildung nur einen Bildungsabschnitt dar, da sie einen akademischen Beruf anstreben (vgl. TULLY 2004, S. 94 DEUTSCHE SHELL 2002, S. 64 f.). Damit entwickeln sich dynamische und differente Übergangsorientierungen in den Erwachsenenstatus bis hin zur Verweigerung aufgrund erschwerter Zugangsbedingungen zum Arbeitsmarkt (vgl. REINDERS 2004, S. 12 ff.). Immanenter Widerspruch? Berufswahl fällt schwer. Doch gerade das wird als mangelnde Berufsorientierung gedeutet und kritisiert. Die Forderung der Wirtschaft nach klaren Berufsvorstellungen bei den Jugendlichen ist höchst widersprüchlich, insofern sie sich weigert, zu deren Realisierung konsequent beizutragen. Das gilt auch für die traditionellere Entwicklungsorientierung von FacharbeiterInnen, die weiterhin einem „(berufs-)biografischen“ Konzept folgen, denen aber die Betriebe Entwicklungschancen versagen, welche von den Jugendlichen gesucht werden (vgl. BAETH-GE 1998). Dabei gehen die theoretischen Modelle an der Realität vorbei, weil die Be-rufswahlentscheidung von Jugendlichen als punktuell-situativ und nicht als ein in verschiedene Phasen gegliederter Prozess gesehen wird. Aber der Überblick fehlt nicht nur, sondern kann auch nicht mehr durch berufsorientierende Vorbe-reitung vermittelt werden. Berufswahl ist ein Prozess sukzessiver Problemlösung, dem die Optionslogik der Jugendlichen entspricht (vgl. GRIEPENTROG 2001). Schule Jugendliche wachsen heute unter deutlich anderen Bedingungen als ihre Eltern auf. Wird „PISA“ ernst genommen, muss wohl auch nach weiteren Ursachen für das unterschiedliche Abschneiden der Teilnehmerstaaten gefragt werden. So sehen sich deutsche SchülerInnen unter einem als hoch wahrgenommenem Leistungsdruck, finden aber geringere Unterstützung und Beziehungsqualität. Der Unterricht in Deutschland ist wenig schülerInnenorientiert, während „es in anderen Nationen zu gelingen scheint, Schule als Lernumwelt so zu gestalten, dass Unterstützungsangebote und Förderungsbemühungen im Vergleich zu Leis-tungsanforderungen – zumindest aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler – im Vordergrund stehen. Dass eine derartige Gestaltung der Lernumwelt Schule nicht zu Einbußen auf der Leistungsseite führen muss, zeigen die Ergebnisse, die die skandinavischen Länder oder Japan in den internationalen Schulleistungsstudien erzielen“ (vgl. CLAUSEN 2003, S. 198 f.). Die pauschale Behauptung, SchülerInnen seien unterfordert, und die Rede von der „Kuschelpädagogik“ zeugen von Unwissenheit. … Jugendliche entwickeln heute Kompetenzen für Probleme, die ihre Eltern nicht einmal kannten. „Im Gegensatz zu ihrer Elterngeneration erfahren sie Einstellungen, Normen und Orientierungen in ihrer Vielfalt und Widersprüchlichkeit und gehen konstruktiv mit der Pluralität unserer Gesellschaft um. Von eindeutigen Vorgaben zur Bewertung von Lebenszusammenhängen und Lebensgestaltung distanzieren sie sich verständlicherweise – und gezwungenermaßen“ (BMFSFJ 2002, S. 191). Deshalb verändert sich auch die „Leistungsbereitschaft“, die als Teil der „Ausbildungsfähigkeit“ gilt (THIES 2001, S. 11). Der Leistungsbegriff Jugendlicher entspricht kaum dem der ArbeitgeberInnen beziehungsweise dem der Elterngeneration. Tatsächlich taugen die alten Leistungsargumente im globalen Kapitalismus ohnedies nicht. Es gibt immer einen, der billiger arbeitet, Leistung entscheidet eben nicht mehr über Erfolg beziehungsweise Misserfolg. Jugendliche entwickeln daher ein instrumentelles Arbeitsverständnis (vgl. ZOLL 1993). Ihre zentrale Frage lautet: „Was bringt mir das?“ Investitionen in den Beruf werden wohl überlegt, Karriereorientierung und die Bereitschaft zu längerer Arbeit sind zwar vorhanden, aber anders motiviert. Überwiegend betrachten Jugendliche die Arbeitswelt der Eltern eher skeptisch, nur wenige wollen in die Fußstapfen ihrer Eltern treten, ein Drittel lehnt das Arbeitsleben der Eltern generell ab. Ein Leben ohne Arbeit beziehungsweise ein Arrangement mit Arbeitslosigkeit ist für Jugendliche durchaus vorstellbar. Nur eine Minderheit der Jugendlichen räumt dem Berufsleben noch Priorität gegenüber dem Privatleben ein (vgl. RAAB 1996). Jugendliche folgen hier tatsächlich einem kulturellen Modell, das sich von dem ihrer Eltern unterscheidet. Vermutlich entstehen daraus die Zweifel an der „Ausbildungsfähigkeit“ der Jüngeren seitens der beurteilenden Älteren. Denn entsprechend geben AusbilderInnen und LehrerInnen zu Protokoll, dass sie früher besser mit den „Azubis“ zurechtkamen, heute dagegen „keinen Zugang mehr zu den Jugendlichen finden und dadurch auch den Eindruck gewinnen, diese interessierten sich nicht für ihre Ausbildung“ (BIBB 2002, S. 5). Die Auszubildenden selbst sehen dies anders: Kaum einer ist wenig oder gar nicht an der Arbeit interessiert. Allerdings: Ob sich Interesse überhaupt auf den Prüfungserfolg auswirkt, lässt sich nicht nachweisen (vgl. ebd., S. 4 ff.). Die Welt der Jugendlichen unterscheidet sich also einerseits klar von der der Erwachsenen, andererseits verschwimmen die Grenzen im Bereich des Konsums. Ganze Industriezweige leben von Jugendlichen sowie deren Zeit- und Geldinvestitionen. Bisher konnten keine negativen – aber auch keine positiven – Wirkungen der von circa 75 % der Jugendlichen ausgeübten Nebenjobs auf die Schulleistung beziehungsweise ent-sprechenden Zeitaufwendungen nachgewiesen werden. Schule und Arbeit koexistieren. Neben Schule bereitet der Nebenjob auf die Arbeitswelt vor. Hier sind die Befunde jedoch kontrovers, denn Jobs vermitteln einerseits Arbeitserfahrun-gen und fördern Tugenden, andererseits werden oft monotone Tätigkeiten ausge-übt. Den Jugendlichen selbst geht es vor allem um Geld, erst mit deutlichem Ab-stand folgen berufsbezogene Motive (vgl. TULLY 2004). Dialektik Jugendliche wissen, dass Erwerbsarbeit ein entscheidendes Integrationsinstrument in unsere Gesellschaft und die eigene Jugendkultur ist. Dabei geht es auch um Zwänge, da Zugehörigkeitssymbole wie Handy und Markenkleidung bezahlt werden müssen. Jugendliche streben danach, „erfolgreiche Jugendliche“ zu sein. Das bedeutet vor allem, den Standards der Gleichaltrigen zu genügen. Wer die genannten Anforderungen nicht bewältigen kann, leidet unter mangelndem Selbstwert und Selbstvertrauen aber auch unter psychischen, gesundheitlichen und sozialen Belastungen. Davon profitiert auch die Wirtschaft, die Jugendkulturen unterwandert beziehungsweise entwickelt und sich den Gruppen- und Normzwang zunutze macht. Zugleich scheint sich dabei dialektisch ein Bedürfnis der Jugendlichen nach Selbstverwirklichung zu etablieren. Vielleicht trägt hierzu das überwiegend als positiv bewertete Verhältnis zu den Eltern und die gesellschaftliche Akzeptanz der Jugendphase als eigenständiger Lebensabschnitt bei. Parallel zum Zwang zu reflexiver Selbstkontrolle entwickelt sich ein hoher Grad an Selbstzentriertheit und die Neigung zur egoistischen Interessendurchsetzung. Jugendliche versuchen, das Beste aus ihrer Situation zu machen und sondieren ihre Chancen. Dennoch: Die Feststellung eines Jugendlichen, dass Arbeit immer wichtig ist, denn Freizeit habe man immer, Arbeit hingegen nicht (IG METALL 2002, S. 93), verweist wiederum auf eine starke Arbeits- statt Freizeitorientierung. Null-Bock-Generation ? Die Verlängerung der Jugendphase wird aber ebenso als Belastung erlebt. Die Lebenslaufgestaltung beginnt deutlich früher als bei der Elterngeneration. Jugendliche entwickeln aufgrund anderer Anforderungen auch andere Kompetenzen als ihre Eltern. Die erheblich längere Schul- und Ausbildungszeit ist mit einem höheren Erwartungsdruck der Eltern – Ziel: Abitur – verbunden. Dennoch besteht trotz aller Anstrengung das massive Risiko des sozialen Abstiegs auf-grund der Entwertung der Bildungsab-schlüsse. Deshalb richten sich Jugendliche auf den engen Arbeitsmarkt ein und arrangieren sich sogar mit ungeliebten Berufen. Sie personalisieren strukturelle Effekte und transformieren sie in Eigenverantwortung. Faktisch lässt sich nach-weisen, dass der Berufsfindungsprozess vielfach hochgradig vom Zufall bedingt ist und sich oft erst retrospektiv als Erfolg darstellt. Wer keine Lehrstelle findet, reduziert seine Ansprüche und akzeptiert die Folgen (vgl. HEINZ 1987 BÖTTGER/SEUS 2001). Resignation tritt bei Jugendlichen kaum auf, stattdessen halten sie am Anspruch qualifizierter Ausbildung fest und leisten ein Gefühl „freier Entscheidung“ durch eine „biografische Konstruktion“ im Sinne von: „Das wollte ich schon immer werden“. Das ermöglicht, schulische Selektionsmechanismen und die Fol-gen konjunktureller Entwicklungen als Chance zu begreifen (vgl. WAHLER/WITZEL 1996, S. 10). Falsche Diagnosen – falsche Lösungen Können also unter völlig veränderten Rahmenbedingungen die Erwartungen an Jugendliche heute noch dieselben wie gestern sein? Kann ein ebenso einfaches wie unklares Konstrukt wie das von der Ausbildungsfähigkeit überhaupt tragen? Vieles spricht dafür, dass es die Wirklichkeit mehr verdunkelt als erhellt, mehr Probleme schafft als löst: Die Veränderungen auf der Angebotsseite des Arbeitsmarktes bleiben offensichtlich nicht ohne Folgen auf der Nachfrageseite. Diese sind als potenzielle Chance begreifbar, urteilt man nicht mit dem fragwürdigen Blick der Arbeitsgesellschaft. Arbeitslosigkeit ist kein Qualifikationsproblem und das Problem „Ausbildungsfähigkeit“ ist Ausdruck der Krise der Arbeitsgesellschaft. Sicher gibt es Qualifikationsdefizite, doch diese sind allenfalls Selektionskriterien, die Ränge nach Konjunkturlage bestimmen. Die so genannte Liberalisierung und die Ausweitung des Terrors der Ökonomie auf die gesamte Lebenswelt und das „Unternehmen Schule“ sowie seine „pädagogischen Führungskräfte“ (BDA 2003, S. 16) führen in Sackgassen….“ – Ausbildungsfähigkeit.pdf
Quelle: http://www.sozialextra.de/2005-05/se2005-05-06-6.pdf
Dokumente: Ausbildungsfaehigkeit.pdf