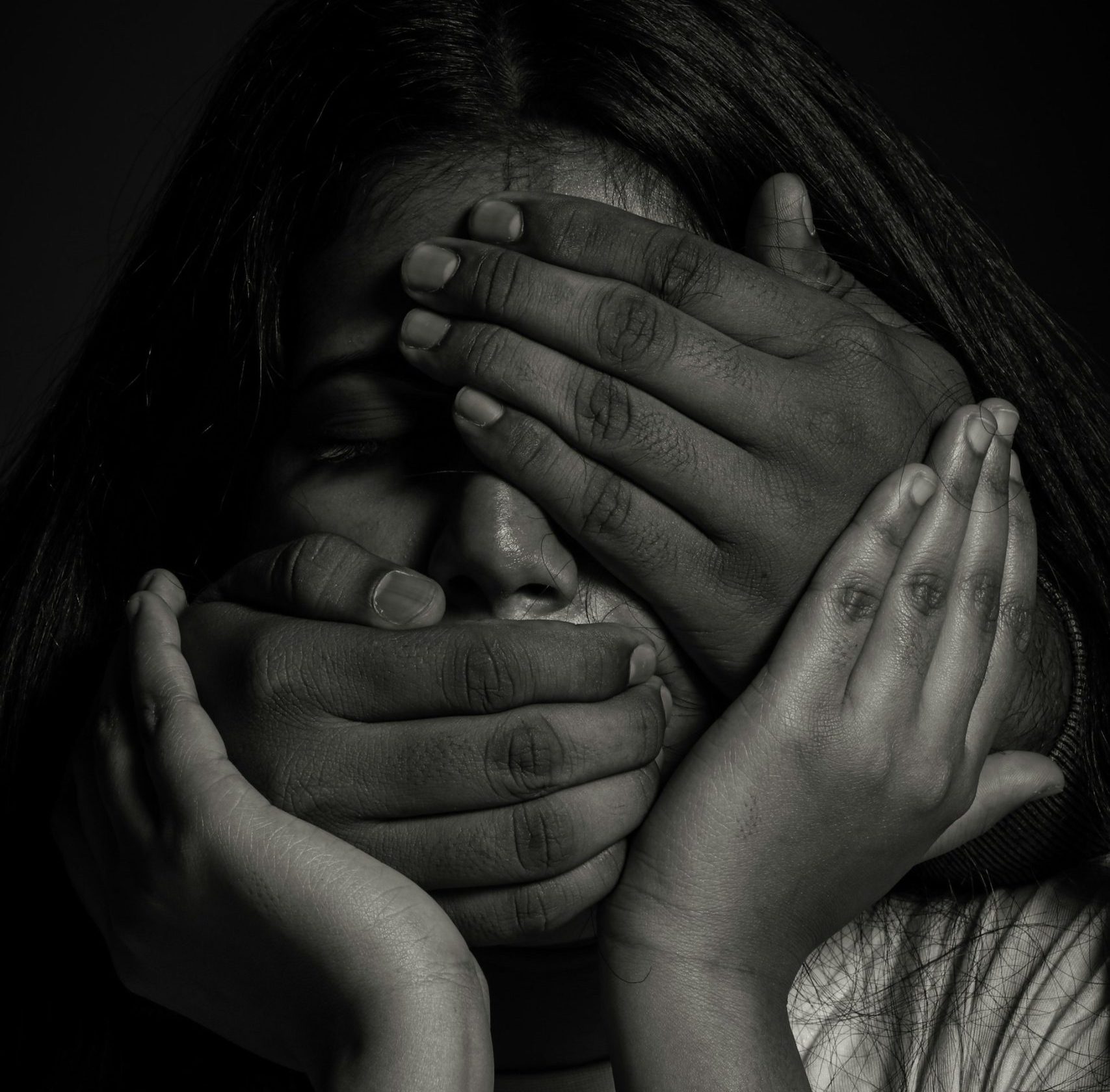Die vorliegende Studie beziffert die bei den öffentlichen Haushalten anfallenden gesellschaftlichen Folgekosten. Sie unterscheidet dabei vier fiskalisch bedeutsame Kostenarten: entgangene Lohnsteuern, entgangene Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, auszuzahlendes Arbeitslosengeld I und Sozialleistungen. Damit beschreitet die Studie wissenschaftlich Neuland – vergleichbare Untersuchungen liegen für Deutschland bisher nicht vor.
Die Kosten unzureichender Bildung werden bestimmt, indem die Folgekosten der heutigen Bildungs- und Ausbildungsverteilung mit denjenigen verglichen werden, die sich bei einem besseren Qualifikationsniveau ergeben. So in einem ersten Szenario wird angekommen, dass sich der Anteil unzureichend Gebildeter um 20 Prozent verringert. In einem zweiten Szenario geht man davon aus, dass sich die Zahl der heute unzureichend Gebildeten halbiert.
Grundlage der Kostenschätzungen sind dabei Querschnittsdaten aus dem Mikrozensus, Daten des Sozio-oekonomischen Panels und die Lohn- und Einkommensteuerstatistik. Mit ihrer Hilfe werden die Erwerbsprofile und die Erwartungseinkommen im Lebensverlauf für verschiedene Bildungsgruppen simuliert. Diese Berechnungen werden ebenfalls für die hypothetisch angenommenen besseren Bildungsverteilungen durchgeführt. Für beide Szenarien wird daraufhin untersucht, wie sich die kumulierten Barwerte gegenüber den heutigen Werten verändert haben. Die Folgekosten unzureichender Bildung bestehen dann in dem Differenzbetrag zwischen der heutigen Situation und einer hypothetisch angenommenen Situation mit niedrigeren Anteilen unzureichend gebildeter junger Erwachsener.
Auszüge aus der Studie „Unzureichende Bildung: Folgekosten für die öffentlichen Haushalte“ des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung:
„… Ausgangslage
In unserer heutigen Informations- und Wissensgesellschaft entscheiden Bildung und Ausbildung maßgeblich über die Chance auf Teilhabe und wirtschaftlichen Wohlstand. Empirische Studien verdeutlichen dies eindrucksvoll: Für Personen ohne Ausbildungsabschluss besteht ein rund drei bis viermal höheres Risiko, arbeitslos zuwerden als für Fachkräfte. Seit den 1990er Jahren ist dieses Risiko zudem merklichgestiegen. Dabei sind die meisten Arbeitslosen sogar dauerhaft von Erwerbslosigkeit bedroht. Auch der Zusammenhang zwischen individuellem Bildungsniveau und der Höhe des Erwerbseinkommens ist empirisch gut belegt: Mit jedem Jahr, das nicht in Bildung und Qualifikation investiert wurde, fällt das Erwerbseinkommenum 7 bis 15 Prozent geringer aus.
Was für jede einzelne Person gilt, lässt sich auch für Gesellschaften insgesamt nachweisen. Ist eine Bevölkerung höherqualifiziert, so begünstigt dies Wirtschaftswachstum und Produktivität. Infolgedessen steigen auch die Steuereinnahmen und das Beschäftigungsniveau – während die Arbeitslosigkeit sinkt. Gleichzeitig verringern sich Transferzahlungen für Lohnersatzleistungen und soziale Sicherung. Ebenso fallen in den Bereichen Gesundheit und Kriminalität für die Gesellschaft geringere Kosten an. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass unzureichende Bildung Ausgaben verursacht, die nicht entstehen würden, wenn mehr Menschen besser gebildet und ausgebildet würden. Dennoch sind die gesellschaftlichen Folgen von unzureichender Bildung vergleichsweise wenig erforscht. Insbesondere fehlen Studien, die verschiedene Bildungsgruppen und deren Entwicklung über einen längeren Zeitraum verfolgen und in der Analyse berücksichtigen.
In Deutschland leben viele niedriggebildete Menschen. Definieren wir eine fehlende berufliche Ausbildung als niedrige und damit unzureichende Bildung, so sprechen wir hier über jeden siebten jungen Erwachsenen. Gegenwärtig beginnen damit rund 150.000 junge Erwachsene pro Jahr ihr Erwerbsleben mit recht düsteren Aussichten. Betrachtet man die Bevölkerung im Alter zwischen 25 und 65 Jahren, so finden sich mehr als sieben Millionen Männer und Frauen ohne berufliche Ausbildung. Menschen mit unzureichender Bildung stellen in Deutschland also keineswegs eine Randgruppe dar. Entsprechend hohe Folgekosten sind aufgesamtgesellschaftlicher Ebene zu erwarten. …
Untersuchungsansatz und Datengrundlage
Um die Folgekosten unzureichender Bildung zu bestimmen, vergleichen wir den heutigen Bildungsstand der Bevölkerung mit einem fiktiv höheren Bildungsstand der Bevölkerung. Insbesondere schätzen wir hierbei die durcheine bestimmte Bildungsverteilung entstehenden staatlichen Einnahmen und Ausgaben über einen Zeitraum von bis zu 35 Jahren. Bei den Einnahmen handelt es sich um Steuerzahlungen und die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Bei den Ausgaben berücksichtigen wir Sozialleistungen in Phasen der Arbeitslosigkeit. Die Differenz zwischen den heutigen Folgekosten und denjenigen, die bei einer günstigeren Bildungsverteilung entstehen würden, bezeichnen wir als Folgekosten unzureichender Bildung. Wir weisen diesen Unterschied als abdiskontierte Differenz, also als Barwertdifferenz aus. Diese beziffert den für die öffentliche Hand realisierbaren Ertrag, wenn es gelingt, die unzureichende Bildung abzubauen. …
Um schließlich die Barwerte je Szenario hochrechnen zu können, werden die gruppenspezifischen, altersbedingten Erwartungswerte mit der Größe der jeweiligen Bildungsgruppe multipliziert. Nähmen wir ein höheres Bildungsniveau in der Gesellschaft an, dann ließe sich so die Barwertdifferenz als Kostengröße identifizieren. Diese ergibt sich daraus, dass es in der Gesellschaft ein geringeres anstelle eines hypothetisch höheren Bildungsniveaus gibt. Diese Barwertdifferenz entspricht dann den Folgekosten unzureichender Bildung. …
Definition unzureichender Bildung
Bei unseren Berechnungen definieren wir unzureichende Bildung als das Fehlen von Schulabschlüssen und Ausbildungsabschlüssen. Diese Festlegung stützt sich auf empirische Befunde:
Menschen ohne Schulabschluss und ohne Ausbildungsabschluss tragen hohe Arbeitsmarktrisiken, sie sind häufiger und oft dauerhaft arbeitslos.
Die Messungvon (unzureichender) Bildung und Ausbildung durchformale Abschlüsse ist angesichts alternativer Möglichkeiten sorgfältig zu begründen. So wäre es denkbar, hiermit kognitiven Kompetenzen und nicht mit Abschlüssen zu arbeiten. Ebenso könnte man statt einer absoluten Schwelle (kein Schulabschluss, kein Ausbildungsabschluss) auf relative Messgrößen der Bildungsverteilung zurückgreifen – … .
In jedem Fall ist eine saubere und transparente Messung von Bildung zwingend geboten, da sich der Anteil von Menschen, die als unzureichend gebildet betrachtet werden, und damit die Folgekosten von unzureichender Bildung je nach Vorgehen deutlich unterscheiden. Würde man hier kognitive Kompetenzen und nicht Abschlüsse zugrunde legen, so wäre der Anteil unzureichend Gebildeter wesentlich höher. Gleiches gilt für relative statt absoluter Bildungsmessungen. …
Wir unterscheiden Bildungsgruppen nachdem Niveau ihrer schulischen Bildung und nach ihren beruflichen Ausbildungsabschlüssen. Mit Blickauf das Schulbildungsniveau einer Person lassen
sich insgesamt vier Kategorien differenzieren: ohne Schulabschluss (Kategorie 0), mit Hauptschulabschluss (Kategorie 1), mit Realschulabschluss (Kategorie 2) sowie mit Hochschulreife (Kategorie 3). Im Bereich der beruflichen Ausbildung finden wir drei weitere Kategorien: kein Abschluss bzw. Berufsvorbereitungsjahr und Anlernausbildung (Kategorie 0), Ausbildungsabschluss (Lehrausbildung, Kategorie 2) sowie höhere Ausbildungsabschlüsse (Kategorie 3). Zu Kategorie 3 zählen wir Hochschulabschluss sowie andere höhere Abschlüsse wie Meister, Fach- oder Berufsakademie und Verwaltungsfachhochschule.
Werden nun schulisches und berufliches Bildungsniveau miteinander kombiniert, ergeben sich zwölf mögliche Bildungsgruppen. Einige dieser Gruppen sind jedoch sehr klein. Blendet man diese aus, ergeben sich für unsere Analyse insgesamt neun Bildungsgruppen.
Ein unzureichendes Bildungsniveau weisen unserer Definition zufolge die Gruppen 00, 10 und 20 auf.
## 10 Personen mit Hauptschulabschluss und ohne Ausbildungsabschluss
## 11 Personen mit Hauptschulabschluss und mit Ausbildungsabschluss (betriebliche Ausbildung)
## 20 Personen mit Realschulabschluss und ohne Ausbildungsabschluss
## 21 Personen mit Realschulabschluss und mit mit Ausbildungabschluss (betriebliche Ausbildung)
## 22 Personen mit Realschulabschluss und einem „höheren“ Ausbildungsabschluss (Meister, akadem. Abschluss)
## 30 Personen mit Hochschulreife und mit Ausbildungabschluss (betriebliche Ausbildung)
## 32 Personen mit Hochschulreife und einem „höheren“ Ausbildungsabschluss (Meister, akamdemischer Abschluss)…
Folgekosten
Die Folgekosten entstehen natürlich nicht nur für die 150.000 Personen, die jedes Jahr ohne Ausbildungsabschluss neu in ihr Berufsleben starten. Angesichts von hochgerechnet etwas mehr als sieben Millionen Menschen im Alter zwischen 25 und 65 Jahren, die keine berufliche Ausbildung abgeschlossen haben, dürften sich die gesamten Folgekosten auf einen beachtlichen – nicht konkret bezifferbaren – Gesamtwert summieren. Und mehr noch: Wenn wir jetzt nicht entschieden Reformen in die Wege leiten, kommen in den folgenden zehn Jahren hochgerechnet weitere 15 Milliarden Euro an Folgekosten hinzu.
Betrachten wir die entstehenden Kosten im Einzelnen. Von den vier Kostenarten, aus denen sich die Folgekosten unzureichender Bildung bei der öffentlichen Hand zusammensetzen, stellen die entgangenen Lohnsteuern mit einem Anteil von 70 Prozent den größten Kostenfaktor dar. Transferzahlungen in Form von Arbeitslosengeld und Sozialleistungen spielen mit rund 17 Prozent eine nachrangige Rolle.
Ordnet man die Folgekosten den verschiedenen föderalen Ebenen in Deutschland zu, so zeigt sich, dass der Bund etwas mehr als 40 Prozent der gesamten Folgekosten trägt. Auf die Bundesländer entfallen etwa 30 Prozent der Kosten, auf die Kommunen und die Bundesagentur für Arbeit jeweils etwa 15 Prozent. Bildungspolitische Reformen, mit deren Hilfe die Zahl der jungen Erwachsenen ohne Ausbildungsabschluss reduziert wird, rechnen sich damit für alle föderalen Ebenen. Ein besonderes Interesse an der Umsetzung solcher Reformen müsste jedoch auf Bundesebene bestehen – sie zahlt am meisten für die Folgen unzureichender Bildung. … Fehlende Bildung wirkt sich gesellschaftlich jedoch nicht nur auf die öffentlichen Haushalte aus, sie beeinflusst auch die Bereiche Kriminalität und Gesundheitsverhalten und verursacht hier weitere erhebliche Kosten. Sozialkapital, freiwilliges Engagement und gesellschaftlicher Zusammenhalt sind ebenfalls eng mit Bildung verbunden und tragen maßgeblich zur politischen und wirtschaftlichen Stabilität eines Landes bei. Eine makroökonomische Betrachtung kann hier am ehesten die langfristig mit Bildungverbundenen enormen Wachstumseffekte für die Gesellschaft aufzeigen.
Alle Berechnungen von Folgekosten unzureichender Bildung belegen, dass Investitionen in Bildung und ein chancengerechtes Bildungssystem hohe Erträge erwarten lassen. Niedrigstqualifizierte Menschen müssen daher Bildungschancen und Perspektiven für Teilhabe am sozialen und
beruflichen Leben erhalten. Mit diesem entscheidenden Schritt lassen sich nicht nur individuelle Tragödien vermeiden. Auf diese Weise wächst auch die Produktivität der deutschen Wirtschaft und unsere Staatshaushalte werden konsolidiert, sodass wir die stetig ansteigenden Sozialausgaben in den Griff bekommen. Das zeigt die vorliegende Studie sehr deutlich. Für jeden jungen Menschen ohne Ausbildungsabschluss könnten in heutigem Gegenwartswert rund 22.000 Euro investiert werden, ohne dass bei denöffentlichen Haushalten zusätzliche Kosten entstehen würden. Addiert man diese Beträge zu all den Ausgaben, die wir heute bereits für Maßnahmen im Schulsystem (Klassenwiederholungen, Förderschulen etc.) oder im Übergangssystem aufwenden und die leider wenig Wirkung hinsichtlich fairer Bildungschancen zeigen, lässt sich im Bildungssystem viel bewegen. …
Diskussion
… Unsere Berechnungen ergeben, dass sich die Kosten unzureichender Bildung bereits für eine einzige Kohorte über einen Zeitraumvon 35 Jahren zu erheblichen Beträgen aufsummieren. Halbiert man die Anzahl unzureichend gebildeter Personen in einem Jahrgang von heute 150.000 auf 75.000 junge Menschen, so könnte dies langfristig zu Einsparungen bzw. Mehreinnahmen von rund, 5 Milliarden Euro führen – und dies allein im Bereich von Lohnsteuern, Sozialleistungen und Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung. Legt man diese Summe um und fragt, welche Kosten heute jeder bildungsarme Mensch verursacht, so erhält man einen Betrag von etwa 22.000 Euro. …
Welche Handlungsempfehlungen lassen sich nun aus den Berechnungen ableiten? Oberstes Ziel muss sein, den Anteil bildungs- und ausbildungsarmer Menschen zu verringern. Dies kann nur durch eine konsequente Abkehr von einer reparierenden, am Schadensfall ansetzenden Sozialpolitik geschehen. Sie muss sich hin zu einer präventiv ausgerichteten Bildungspolitik öffnen. Wenn wir wissen, dass heute für jeden unzureichend Gebildeten Folgekosten von 22.000 Euro entstehen, so sollte zukünftig mindestens dieser Betrag dafür verwendet werden, das Risiko von Bildungsarmut deutlich zu verringern.
Eine solch präventiv ausgerichtete Sozialpolitik muss früh im Lebensverlauf ansetzen.Wir brauchen einen zügigen und qualitativ hochwertigen Ausbau der Kindertagesstätten mitgeschultem
Personal, welches Kinder mit Problemen schnell identifiziert und ihnen gut zu helfen weiß. Das kostet Geld, doch es hilft: Der positive Zusammenhang zwischen frühkindlicher Bildung und langfristigem
Bildungserfolg ist längst hinreichend belegt und quantifiziert. Wir benötigen vergleichbare pädagogische Standards, zumindest auf Länderebene. Um diese zu entwickeln, müssen wir uns von den vielen Modellprojekten verabschieden, die unverbunden nebeneinanderstehen und deren Wirkung nicht untersucht wird. In 16 Bundesländern werden heute über zwanzig unterschiedliche Sprachstandserhebungen eingesetzt. Ausgerechnet jener mit der geringsten Prognosekraft wird am häufigsten verwendet.
Wir brauchen Ganztagsschulen, damit Kinder von erwerbstätigen Eltern nicht zu früh auf sich alleine gestellt sind. Zudem lassen sich so im Lehrplan auch die wichtigen �weichen’ Fächer besser berücksichtigen. Neben den Lehrerinnen und Lehrern ist hier Personal gefragt, welches
Problemlagen frühzeitig erkennt und benennt. Gerade für Risikoschüler sind systematische, individualisierte Angebote in den Schulen unerlässlich. Dabei geht es um mehr als die Ausbildung kognitiver Fähigkeiten. Es gilt ebenso, die sozialen Kompetenzen junger Menschen zu entwickeln. Hier müssen die Schulen stärker in die Pflicht genommen werden. Unternehmen beklagen häufig, dass Bewerberinnen und Bewerbern wesentliche Ausbildungsvoraussetzungen wie Pünktlichkeit, Verlässlichkeit und Höflichkeit fehlen. Damit die Schülerinnen und Schüler diese Sozialkompetenzen erlernen können, müssen die Schulen nach internationalem Vorbild mit Sozialarbeitern und Psychologen zusammenarbeiten und sich im Stadtteil vernetzen. Wenn Schulen und Betriebe eng miteinander kooperieren und beispielsweise praxisnahen Unterricht anbieten, kann dies auf die jungen Menschen motivationsfördernd wirken.
Die Ausbildungsbetriebe selbst tragen ebenfalls Verantwortung. Zu viele Betriebe sind nicht ausbildungsberechtigt. Von den ausbildungsberechtigten Betrieben wiederum bildet tatsächlich nur
jeder zweite aus. Hier bietet sich an, die betriebliche Ausbildung stärker im Verbund zu organisieren. In wirtschaftlich benachteiligten Gebieten könnte zudem die Ausbildungslosigkeit nach ostdeutschem Vorbild durch die staatliche Finanzierung außerbetrieblicher Ausbildungen verringert werden. …
In Deutschland existieren für Menschen mit niedrigen Schulabschlüssen unzählige Maßnahmen im sogenannten Übergangssystem. Diese sind kaum standardisiert. Zudem bestehen erhebliche Zweifel, ob diese Maßnahmen dabei helfen, die jungen Menschen in Ausbildung zu bringen. Stattdessen könnten hier verstärkt niedrigschwellige und anerkannte zweijährige Ausbildungen geschaffen werden, die allerdings auch weiterhin deren Anschluss an die bestehenden dreijährigen Ausbildungen ermöglichen. Wir brauchen folglich nicht nur ein größeres Angebot an Ausbildungsplätzen, sondern passgenaue und flexible betriebliche Strategien, die junge Menschen dazu befähigen, eine Ausbildung zu beginnen und sich weiter zu qualifizieren. Diese Ansätze müssen den unterschiedlichen Qualifikationen und Motivationen der jungen Menschengerecht werden. … „
Autoren der Studie: Jutta Allmendinger, Johannes Giesecke und Dirk Oberschachtsiek.
Die Studie in vollem Textumfang entnehmen Sie bitte aufgeführten Links oder dem Anhang.
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-34440681-A4497D2B/bst/hs.xsl/nachrichten_106530.htm?drucken=true&
http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_dms_33657_33658_2.pdf
http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_dms_33661_33662_2.pdf
Quelle: Bertelsmannstiftung
Dokumente: Unzureichende_Bildung_Folgekosten_oeffentliche_Haushalte.pdf