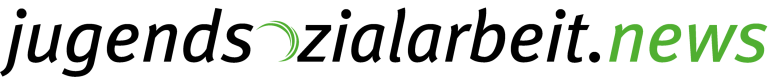INTERRELIGIÖSER DIALOG ZWISCHEN CHRISTEN UND MUSLIMEN – EIN THESENPAPIER In den letzten ‚Nachrichten der Katholischen Fachhochschule NW‘ setzte Prof. Dr. Josef Freise sich mit den Herausforderungen des interreligiösen Dialogs und den daraus resultierenden Aufgaben für Katholische Hochschulen auseinander. In diesem Beitrag legt er den Fokus auf die kirchliche Jugend(sozial)arbeit und deren Rolle in einem interreligiösen Dialog: “ Der Rockmusiker Herbert Grönemeyer geht derzeit mit neuen Liedern auf Deutschlandtournee und das erste Lied seiner neuen CD lautet: „Ein Stück vom Himmel“: „…ein Stück vom Himmel, der Platz von Gott, Du bist überdacht von einer grandiosen Welt, Religionen sind zu schonen, sie sind für die Moral gemacht…“ Religion im Allgemeinen und der interreligiöse Dialog im besonderem sind en vogue, ein „Megathema“ in der Öffentlichkeit. So bringt die Wochenzeitung Die ZEIT derzeit eine Serie zu den sechs Weltreligionen. Der Islam steht bei den Debatten um Religion im besonderem Focus: Das Zweite Deutsche Fernsehen plant im Internet ein muslimisches „Wort zum Freitag“ und überlegt, ob es auch im Fernsehen einen Sendeplatz bekommt. Der Bau von Moscheen schlägt regelmäßig hohe Wellen. Mit den türkischen Arbeitsmigranten kamen Muslime in großer Zahl nach Deutschland. Dass Religion und hier insbesondere der Islam im Brennpunkt öffentlicher Aufmerksamkeit steht, hat mit dieser Einwanderung zu tun. Lange hielt man sich an die These, dass die religiöse Bindung mit einem Ortswechsel nachlässt. Zunehmend zeigt sich jedoch, dass Religion die Chance der Beheimatung in der Fremde bietet. Religion als „portable Heimat“ ist nicht nur für die zugewanderten Muslime, sondern auch für die zugewanderten orthodoxen Christen aus Griechenland und die katholischen Christen aus Polen, Italien, Spanien und Portugal von Bedeutung. Sie leben ihren Glauben intensiver und offensichtlicher als die einheimischen Christen. Wenn man den Gottesdienstbesuch von Zugewanderten und Einheimischen in Deutschland vergleicht, dann kann man für die Wochenenden in Hamburg, Berlin, Frankfurt und München sagen, dass dort mehr Zugewanderte die Kirchen und Moscheen besuchen, als dass Einheimische in den Kirchen zu finden sind. Wenn es einen Unterschied bei Einstellungen und Verhaltensweisen zwischen einheimischen Jugendlichen und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien in Deutschland gibt, dann ist es der Bezug zur Religion: Jugendliche mit Migrationshintergrund sind im stärkeren Maße religiös als einheimische Jugendliche, und das gilt sowohl für die muslimischen Jugendlichen türkischer und arabischer Herkunft als auch für junge christliche Migranten aus Italien, Spanien, Portugal und Griechenland. In den neuen Bundesländern ist der Zugang einheimischer Jugendlicher zur Religion marginal, in den alten Bundesländern bezeichnet sich 1/3 der einheimischen Jugendlichen als religiös. Aber es sind 2/3 der jugendlichen Zuwanderer, die sich religiös nennen. 1. These: Das neue Interesse an Religion und die Relevanz des interreligiösen Dialogs sind vor allem ein Ergebnis der Zuwanderung. Deutschland ist nicht mehr nur ein Land mit unterschiedlichen christlichen Konfessionen wir sind insbesondere mit den jüdischen Kontingentflüchtlingen aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion und den muslimischen Arbeitsmigranten ein multireligiöses Land geworden. 2. These: In der multireligiösen Gesellschaft bleibt Religion nicht mehr privat, sondern wird öffentlich. Dies ist ein Kennzeichen der postsäkularen Gesellschaft. Jürgen Habermas hat den Begriff der postsäkularen Gesellschaft in seiner Rede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels im Oktober 2001 kurz nach dem Anschlag des 11. September bekannt gemacht und später noch einmal im Gespräch mit dem damaligen Kardinal Joseph Ratzinger im Jahr 2004 ausgeführt. In der nachindustriellen Gesellschaft gewinnen, so Habermas, die Märkte Steuerungsfunktionen in Lebensbereichen, die bisher normativ über politische oder vorpolitische Kommunikationsformen zusammen gehalten wurden. Dadurch gerät gesellschaftliches Handeln immer mehr unter die Logik eines erfolgsorientierten, an eigenen Präferenzen orientieren Handelns. Auf diesem Hintergrund kommt es zu einer Revalitisierung von Religion mit dem Theorem, dass die religiöse Ausrichtung auf einen transzendenten Bezugspunkt aus der Sackgasse einer globalisierten Industriegesellschaft heraus helfen kann. Der Begriff der postsäkularen Gesellschaft beinhaltet nach Habermann zwei Tendenzen: Die weiter voranschreitende Säkularisierung und das Wiedererstarken von Religion. Das Erstaunliche ist, dass der sich als „religiös unmusikalisch“ bezeichnende Philosoph Habermas für die Zukunft empfiehlt, dass säkulare Philosophen die metaphy-sisch-religiösen Ursprünge ihres Denkens reflektieren sollten und dass die Theologen zugleich den Anschluss an die Selbstreflektion der Vernunft weiter suchen sollen. Der Dialog zwischen beiden Richtungen kann einen komplementären Lernprozess beinhalten. Neu ist, dass Religion nicht mehr auf die private Sphäre verwiesen wird nach dem Motto der Aufklärung, dass im öffentlichen Raum mit Argumenten der Vernunft gestritten werden soll und dass die religiösen Überzeugungen des Einzelnen in der Privatsphäre ihren Platz hätten. Habermas betont ausdrücklich, dass die nichtgläubigen Menschen den gläubigen Mitbürgern nicht das Recht bestreiten sollen, in religiöser Sprache Beiträge zur öffentlichen Diskussion einzubringen. Er argumentiert hier ganz ähnlich wie der katholische Theologe Johann Baptist Metz, der in der globalisierten marktfixierten Gesellschaft eine Abkoppelung von religiösen Traditionen sieht. Fremdes Leid, so Metz, werde nicht mehr wahrgenommen, obwohl doch der Universalismus christlicher Prägung gerade darin seinen Ursprung habe, dass es überhaupt kein Leid gibt, das uns nichts angeht. Wie Habermas sieht Metz in dem öffentlichen Dialog mit religiösen Traditionen die Chance, einer Gesellschaft, die immer weniger über die Logik des Marktes und des Tausches hinauskommt, etwas entgegen zu setzen. Metz formuliert eine zentrale Aufgabe des interreligiösen Dialogs so: „Man darf wohl sagen, dass alle großen Religionen der Menschheit um die Mystik des Leidens konzentriert sind. Und das wäre m. E. auch die Basis einer Koalition der Religionen… – im gemeinsamen Widerstand gegen die Ursachen ungerechten und unschuldigen Leidens in der Welt …“ 3. These: Verwurzelung in der eigenen Religion und interreligiöser Dialog in der multireligiösen Gesellschaft gehören zusammen. Erst beides gemeinsam konstituiert religiöse Identität. Zur Identität gehört zu wissen, wer ich bin und wer ich nicht bin. Religiöse Identität entwickelt sich erst in der Auseinandersetzung mit andersreligiösen und nichtreligiösen Vorstellungen. Wir kennen vornehmlich und zum Teil aus eigener Erfahrung das Muster volkskirchlicher Religiosität, bei der Kinder quasi mit der Muttermilch auch eine religiöse Verwurzelung durch religiöse Traditionen und Riten erfahren und darauf aufbauend eine religiöse Erwachsenenidentität entwickeln. Wie aber finden Jugendliche und Erwachsene eine religiöse Beheimatung, wenn sie ohne religiöse Verwurzelung im Elternhaus sich später erst beispielsweise mit dem Katholizismus oder dem sunnitischen Islam vertraut machen? Religiöse Identitätsfindung hat zwei Zielrichtungen: die Beheimatung und Verwurzelung in der eigenen Religion und den friedlichen, wertschätzenden Umgang mit Menschen andersreligiöser oder auch nichtreligiöser Auffassung. Religiöse Beheimatung in der von vielfältigen religiösen und nichtreligiösen Wertvorstellungen geprägten Gesellschaft ist ein komplizierter Prozess, der sowohl intrareligiöses, als auch interreligiöses Lernen. beinhaltet. „Im Haus des Vaters gibt es viele Wohnungen (Joh 14,2).“ Dieses Bibelwort kann man auch so deuten, dass im Himmel Menschen unterschiedlicher Religionen einen Platz finden. Aber Wohnungen sind erst einmal klar abgegrenzte Einheiten, die man öffnen kann und soll und in die man sich auch gegenseitig einlädt. Durch den interreligiösen Dialog sollen die Wohnungen aber nicht zu einem Großraumbüro umgebaut werden, in dem kein Heimatgefühl entsteht und in dem am Ende sich niemand wohl fühlt. Die 4. These bezieht sich auf die Konstruktionen und Bilder in den Köpfen, die auf den interreligiösen Dialog einwirken. 4. These: Der interreligiöse Dialog wird durch dichotomisierende Bilder und Freund-Feind-Schemata behindert und gefährdet. Nach einer Allensbach-Umfrage aus dem Jahr 2004 bringen 83% der befragten Deutschen den Islam mit Terror in Verbindung. 81% halten Muslime für fanatisch und radikal und 70% für gefährlich. Helmar Lutz und Rudolph Leiprecht kritisieren das dichotomisierende Muster auch in Teilen der feministischen Bewegung, mit dem der islamische Mann als Feind der Frauen stilisiert werde. Die Kopftuch tragende Muslima werde entsprechend als Opfer wahrgenommen und ihr werde das Subjektsein abgesprochen. Dichotomisierende Bilder, also Bilder nach dem Schwarz-Weiß-Muster, gibt es im Umgang mit dem Islam in zwei Varianten. Die häufigere Variante ist die Islamphobie. Die andere Variante ist die in Sozialarbeiterkreisen durchaus auch bekannte undifferenzierte und unkritische Islamophilie. Was wir brauchen, sind echte Empathie mit muslimischen Bürgern und authentische Klarheit, die den gegebenenfalls notwendigen Konflikt nicht scheut. Dazu müssen wir aber zuerst einmal persönliche Kontakte mit Muslimen schaffen und Muslime in ihren äußerst unterschiedlichen Prägungen kennen lernen. Die moderne Vorurteilsforschung in den USA untersucht Vorurteile bei Menschen, die sich selbst als liberal und nicht diskriminierend einschätzen und die sich – aus der Mittel- und Oberschicht kommend – differenziert und politisch korrekt ausdrücken können. Deutlichstes Kennzeichen für Vorurteilsanfälligkeit in diesen Kreisen ist, so fand man heraus, die Kontaktvermeidung mit unangenehmen Gruppen und die durchgängig negative Bewertung dieser Gruppen. Wie sprechen wir über Muslime? Reden wir nur über sie oder auch mit ihnen? Wie viel Kontakt zu Muslimen haben wir? Suchen wir ihn oder vermeiden wir ihn? 5. These: Die kirchliche Jugend(sozial)arbeit sollte ein Ort der Begegnung mit muslimischen Jugendlichen und der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Islam werden. Auch wenn sich unsere Gesellschaft weiter säkularisiert und die kirchlichen Institutionen an öffentlichem Einfluss verlieren, so gilt doch zugleich, dass Religion wieder im öffentlichen Fokus ist: Die Shell-Studie „Jugend 2006“ gibt an, dass 21 Prozent der 16- bis 29-Jährigen interessieren sich im Jahr 2006 sehr oder ziemlich für religiöse Fragen, während es 1994 erst 14 Prozent waren. Interessant ist, was Thomas Gensicke im Rahmen der Shell-Studie ‚Jugend 2006‘ in Bezug auf die Verbindung von Werteentwicklung und Religiosität – für christliche wie muslimische Jugendliche – herausgefunden hat: Wer nicht religiös ist, bildet seine Werte im Kontakt mit Familie und Peer-Group. Religiöse Jugendliche sind in ihrer Werteorientierung weniger abhängig von der Meinung der Familie und der Peer-Group. Sie haben eine zusätzliche identitätsbildende Instanz durch ihren Gottesbezug. Auch das innere Selbstgespräch mit Gott, das Gebet, kann also eine solche zusätzliche identitätsbildende Instanz darstellen. Dabei ist es aber wichtig, genau hinzuschauen, was unter dem Begriff der Religion verstanden wird und wie unterschiedlich Religion aussehen kann. Idealtypisch lassen sich vier Formen des Religionsphänomens unterscheiden, die in sich noch differenzierter betrachtet werden müssten und die sich oft auch überlappen: – die Kulturreligion (‚Religion light‘): Menschen fühlen sich einer Religion zugehörig und sehen sich von religiösen Gebräuchen geprägt, ohne jedoch regelmäßig zur Kirche bzw. Moschee zu gehen oder beispielsweise als Muslime die Gebote des Fastens und des Verzichts auf Alkohol einzuhalten. – Die aufgeklärte moderne Religionsform: Religiöse Glaubens- und Verhaltensweisen werden nicht einfach buchstabengetreu aus der Vergangenheit übernommen, sondern in die moderne Zeit transponiert. Die moderne Religionsform geht mit einer individualisierten Religionspraxis einher viele traditionelle Riten und Gebräuche gehen verloren, und es müssen neue gemeinschaftsbildende Traditionen entwickelt werden. – Die traditionsgebundene Religionsform: Sitten und Gebräuche werden streng eingehalten und sind milieubildend. Sie stehen oft im Gegensatz zur Mehrheitsmeinung der Gesellschaft. Mitglieder dieser Religionsform bleiben unter sich, heiraten unter sich und grenzen sich auch ab. Sie halten ihre eigene Religion für die richtige. Bei „weicheren“ Varianten traditioneller Religion werden andere Religionen nicht abgewertet bei einer „härteren“ traditionalistischen Orientierung wird die eigene Religionsform als die einzig akzeptable gesehen und andere Religionen sind dann „vom Teufel“. – Die fanatische und sektiererische Religionsform: Die eigene Religion wird für die einzig wahre gehalten, die notfalls auch mit Gewalt ausgebreitet werden muss. Diese Unterscheidungen sind insbesondere mit Blick auf den Islam von großer Bedeutung. Der Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland vom August 2005 betont: ‚Die große Mehrheit der Menschen muslimischen Glaubens in Deutschland weist keine Nähe zum islamistischen Extremismus auf… Nach Verfassungsschutzbericht gelten rund 1 Prozent der muslimischen Bevölkerung in Deutschland als Anhänger islamistischer Organisationen. Von ihnen gehört der überwiegende Teil zur Anhängerschaft von Mili Görüs und damit zur größten nichtstaatlichen türkischen Organisation und nicht zum gewaltbereiten oder zum gewaltaufrufenden Spektrum‘. Es ist ganz entscheidend, zwischen modernen, traditionalistischen und fanatisch-sektiererischen Religionsauffassungen zu unterschieden. Kopftuch tragende junge muslimische Frauen beispielsweise können zu allen drei Richtungen gehören sie sind eben nicht notwendigerweise unterdrückte Frauen aus Familien mit einer sektiererischen fanatischen Religionsauffassung. Das Kopftuch ist ein ambivalentes Zeichen für starke Religiosität. Es kann Zeichen einer konservativen Religiosität mit der Auffassung sein, nach der das Tragen des Kopftuches durch die Religion vorgeschrieben sei. Es kann aber auch Zeichen eines selbstbewussten modernen Religionsverständnisses sein, wenn Frauen bewusst (manchmal sogar gegen Männer- und Familienwünsche) sich für dieses Symbol entscheiden. Unter muslimischen Jugendlichen nimmt die Bedeutung des religiösen Bezugs zu. Viele Jugendliche setzen sich von dem Kulturislam ihrer Eltern ab und befolgen selbst strenger als ihre Eltern die religiösen islamischen Regeln. Religion wird somit für sie ein Weg, ihre Identität auszudrücken und klarzumachen, wer sie sind und wer sie nicht sind. Die religiöse Orientierung steht dabei nicht im Widerspruch zur Integration: Jugendliche Muslime wollen den Islam in ihr Leben in Deutschland integrieren. Religion fördert Identität, verschafft Orientierung und hilft dann möglicherweise auch, sich vor Kriminalität zu schützen, wenn sie Werte wie die Nächstenliebe vermittelt, das Selbstbewusstsein stärkt und Halt in Krisen gibt, indem der Einzelne auch in schwierigen Situationen als von Gott gewollt und geschützt erfahren wird. Religion leistet keinen Beitrag zu einer gelingenden Identitätsentwicklung, wenn sie autoritär strukturiert ist oder fanatische und sektiererische Züge trägt. Solche Formen religiöser Orientierung sind noch viel zu wenig wissenschaftlich erforscht. Sie müssten in ihren unterschiedlichen Stärkegraden untersucht werden – von schwacher autoritärer Prägung bis hin zu massivem Fanatismus. Es gibt autoritäre Religionsformen, die nach außen hin friedlich erscheinen, aber gewaltsamen Druck auf ihre Mitglieder ausüben. Wenn jemand beispielsweise einen andersreligiösen Partner heiratet, die religiösen Pflichten (Beten, Fasten) nicht erfüllt oder gar konvertieren will und wenn ihm dann mit Ausschluss aus der Familie und mit der Hölle gedroht wird, dann ist hier eine nach außen vielleicht nicht wahrnehmbare, aber doch innere Gewaltförmigkeit der Religion vorhanden. Neben einer solchen inneren, latenten Gewaltförmigkeit religiöser Prägung gibt es dann die offensichtliche Gewaltbereitschaft. Sie ist beispielsweise bei einzelnen Jugendlichen arabischer und auch türkischer Herkunft anzutreffen, die in gewaltbereiten Peer-Groups ein Freund-Feind-Schema pflegen, die sich von den Eltern entfremden und eine Sympathie für terroristische Aktivitäten entwickeln. Ähnlich wie bei rechtsextremen Kreisen ist der Zulauf zu islamistischen gewaltbereiten Gruppen da am ehesten zu erwarten, wo sich Jugendliche selber diskriminiert fühlen und keine eigene berufliche Zukunftsperspektive für sich sehen. Wenn wir uns in der Jugend(sozial)arbeit wirklich auf Begegnungen mit muslimischen Jugendlichen einlassen, dann muten wir uns viel zu. Wir werden Fremdheitserfahrungen machen, die verunsichern: Wo gilt es, Fremdes zuzulassen, wo müssen wir konfrontieren, wenn wir der Auffassung sind, hier werden Grundlagen unserer Werteordnung infrage gestellt, wie die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Toleranz gegenüber nichtreligiösen Menschen usw. Die Kopftuchfrage ist ein Beispiel für diese Verunsicherung. Zu jedem echten Dialog gehören Empathie und Konfliktfähigkeit. Papst Johannes Paul II. hat immer wieder und insbesondere mit der Initiierung der Weltgebetstreffen für den Frieden in Assisi seine Wertschätzung für die anderen Weltreligionen zum Ausdruck gebracht. Papst Benedikt XVI. tut dies ebenso, aber er hat einen weiteren Akzent hinzugefügt: den der inhaltlichen Auseinandersetzung. Auch wenn seine Vorlesung in Regensburg zuerst Missverständnisse hervorgerufen hat, so haben doch nach den Klarstellungen des Papstes achtunddreißig muslimische Gelehrte die Herausforderung zum Dialog angenommen und auf eine intellektuell sehr anspruchsvolle und vom Stil her sehr angenehme Weise reagiert. An solche Diskussionen könnte man auch in der kirchlichen Jugendarbeit und Jugendbildung anknüpfen und fragen: Wie halten es Islam und Christentum mit der Gewalt? Was sagen Bibel und Koran dazu, und was haben Christen und Muslime im Laufe der Geschichte daraus gemacht? Was sagen Islam und Christentum zum Auftrag der Bewahrung der Schöpfung? Wie organisieren Islam und Christentum soziale Verantwortung? Was tun Christen und Muslime gegen Fundamentalisten in ihren eigenen Reihen? In der Jugendsozialarbeit sind Fragen nach der eigenen Identitätsstärkung und nach dem friedlichen Umgang mit Menschen anderer Herkunft und anderer religiöser Auffassung zentral. Inwieweit gibt mir mein Glaube an Gott als Christ oder Muslim Selbstvertrauen, und inwieweit hilft er mir, Menschen mit anderen Einstellungen zu respektieren und sie als Geschöpfe Gottes wahrzunehmen? “ Prof.Dr. Josef Freise (Lehrender für Interkulturelle Soziale Arbeit an der KFH NW im Fachbereich Sozialwesen) Am 10. September 2007 veranstalten dazu die KFH NW, die Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit und der muslimische Verband DITIB eine Fachtagung in Köln zur interreligiösen Jugendarbeit. Als Referenten sind u. a. vorgesehen Dr. Tarek Badawia (Universität Mainz), Bekir Alboga (DITIB), Jugendbischof Dr. Franz-Josef Bode angefragt ist der nordrhein-westfälische Integrationsminister Armin Laschet.
Quelle: Josef Freise