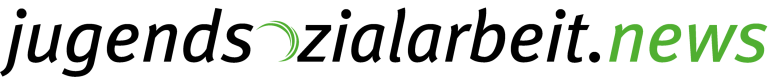Die Wissenschaft ist sich einig, dass hauptsächlich die soziale Herkunft darüber entscheidet, ob Kinder und Jugendliche ein selbstbestimmtes Leben führen können. An welchen Stellschrauben die Politik drehen könnte, erläutern Prof. Dr. Jutta Allmendinger und Prof. Dr. Wolfgang Schröer im Gespräch mit bdkj.konkret, dem Magazin unseres Mitgliedsverbandes, dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).
Laut dem sechsten Armuts- und Reichtumsbericht sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene die Gruppe mit dem höchsten Armutsrisiko. Warum sind sie besonders stark betroffen?
Allmendinger: Die Armut der Kinder ist meist eine Folge der Armut eines Haushalts, also in der Regel der Familie. Hier spiegelt sich die ungleiche Verteilung des Einkommens und der Vermögen in Deutschland wider, auch wenn das im politischen Diskurs so oft nicht akzeptiert wird. Der gesamte relative Armutsbegriff, auf den der Bericht aufbaut, wird gerade in letzter Zeit hinterfragt. Wenn man zu einem absoluten Maß der Armut zurückkehrt, muss man sich mit vielen Fragen nicht beschäftigen. Ich hatte gehofft, dass diese Grabenkämpfe schon lange überwunden sind.
Schröer: Wir diskutieren Jugendarmut häufig als Anhängsel von Kinderarmut. Aber die Armut zwischen dem 14. und 27. Lebensjahr hat noch einmal eine eigene Qualität. Dass wir dort besondere Armutslagen haben, liegt auch daran, dass wir diese Lebensphase in den vergangenen Jahren sozialpolitisch vernachlässigt haben. Vor 40 Jahren gab es mal den Ansatz, junge Menschen – zum Beispiel Schüler*innen, Auszubildende und Studierende – eigenständig und unabhängig von ihrer Herkunft zu fördern. Dies ist sozialpolitisch vollkommen in den Hintergrund gerückt. Jetzt sehen wir die Folgen der Politik der letzten 20 Jahre.
Welche Probleme müsste die Politik genauer in den Blick nehmen?
Allmendinger: Man müsste den Blick richten auf die Entwicklung der Mieten, was ja vor allem diejenigen trifft, die bei ihren Eltern ausziehen. Auch das BAföG müsste dringend reformiert werden, doch die Reform kommt nicht in Gang. Außerdem sind die Möglichkeiten junger Erwachsener, neben der Ausbildung Geld zu verdienen, im vergangenen Jahr mit der Pandemie fast komplett weggebrochen. Viele brauchen aber diese Jobs etwa in der Gastronomie oder im Messebereich, um sich überhaupt ihre Ausbildung leisten zu können. Der Armuts-und Reichtumsbericht berücksichtigt diese Entwicklung noch gar nicht. Aktuell ist das Problem also vermutlich noch größer, als im Bericht dargestellt.
Schröer: Viele der sozialen Verwerfungen der letzten 18 Monate hätte man vorhersehen können. In der Corona-Pandemie sind ja besonders die gut zurechtgekommen, die auf private Ressourcen zurückgreifen konnten, ob das jetzt Ersparnisse waren, die Hilfe der Eltern oder das noch leerstehende Kinderzimmer, in das man sich zurückziehen konnte. Für Jugendliche und junge Erwachsene aber, die allein leben, ist vieles weggebrochen. Für sie gab es quasi keine Unterstützung. Die Folge: Die Schere zwischen arm und reich geht weiter auseinander.
Woran liegt es, dass die Jugendlichen in den Debatten um soziale Gerechtigkeit oder den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie kaum vorkommen?
Allmendinger: In der Debatte war schnell klar, dass für viele Familie und Bildung nur „Gedöns“ sind. Bei der Frage, welche Bereiche wie stark heruntergefahren werden, gab es meines Erachtens nicht mal im Ansatz eine Form der horizontalen Gerechtigkeit. Damit meine ich: Wenn nun mal soziale Interaktionen reduziert werden müssen, muss das auch in allen gesellschaftlichen Bereichen gleichermaßen passieren. Während Schulen und Universitäten geschlossen wurden, gab es für die Unternehmen kaum Auflagen. Zudem hat man ungleiche Tatbestände gleichbehandelt. Natürlich haben es Kinder aus gut situierten Elternhäusern mit genügend Platz und Eltern, die den Schulstoff beherrschen, wesentlich einfacher als Kinder aus finanziell schwachen Familien. Da hätte es eine Anti-Armuts-Politik gebraucht, die diese Ungleichheiten auch ungleich angeht. Diese zwei Verletzungen von Gerechtigkeitsnormen führen dazu, dass sich das Problem der Jugendarmut verschärft. Dabei geht es nicht nur um eine rein materielle Armut. Das übersetzt sich auch in eine gesundheitliche Armut, eine Armut an Sicherheit, eine Armut an Bildung und damit in eine Armut an Chancen im Leben.
Schröer: Die ungleichen Verwirklichungschancen sind ein großes Problem. Das liegt auch an einer sehr reduzierten Politik in den vergangenen Jahren, die gar nicht wahrnehmen will, wie unterschiedlich das soziale Kapital verteilt ist und wie stark der Erfolg im Bildungssystem von der sogenannten sozialen Herkunft abhängt. Corona hat das noch verschärft. Es wurden die zentralen Institutionen, die bei der Verteilung von Chancen ein wenig Ausgleich herstellen, heruntergefahren. Während es für die Wirtschaft große Ausgleichsmaßnahmen gab, gibt es für die jungen Menschen jetzt ein Aufhol-Paket, das letztlich unterstellt, wenn sich alle ein bisschen anstrengen, nachholen und wieder schneller laufen, dann sei das alles kein Problem. Dabei gab es doch schon vor Corona bei der Chancengerechtigkeit riesige Probleme.
Allmendinger: Der Bund hat ja Möglichkeiten – etwa mit dem Bildungs- und Teilhabegesetz. Aber nur sieben Prozent derjenigen, die Anrecht auf eine Lernhilfe haben, rufen die Leistungen tatsächlich ab. Der Bund könnte da viel tun, ohne jede Föderalismus-Diskussion. Man müsste es nur anders zuschneiden: Der Staat sollte nicht darauf warten, dass die Menschen, die hier Hilfe brauchen, sich diese gewissermaßen abholen. Der Staat müsste vielmehr auf diese Menschen zugehen und ihnen beispielsweise über die Schulen Lernhilfen anbieten. Die Mittel dafür könnte man einfach direkt an die Schulen geben, an denen 20 Prozent der Schüler*innen Anspruch auf diese Hilfen haben.
Schröer: Da zeigt sich wieder die Crux, dass man hier sehr individualisiert arbeitet, anstatt die soziale Infrastruktur zu stärken und junge Menschen dort zur Beteiligung und Mitbestimmung einzuladen. Der oder die Einzelne muss sich erst mal strecken, um Hilfe zu bekommen. Aber je nachdem, aus welchem Milieu man kommt, hat man unter Umständen gar keine Möglichkeit, den Antragsdschungel zu durchschauen. Es ist sehr schwer, da an den politischen Mainstream heranzukommen und diese Struktur, die ja Ungleichheit produziert, grundlegend zu ändern.
Braucht die nächste Bundesregierung also ein neues Denken, einen Paradigmen-Wechsel, in der Teilhabepolitik für junge Menschen?
Allmendinger: Man kann schon auf bestehenden Strukturen bauen, man muss sie nur anders schneiden. Die Gesetze sind da. Es muss sich eigentlich nur der Weg ändern, wie die Jugendlichen zu den Hilfen und den Leistungen des Staates kommen. Da brauchen wir ein anderes Denken. Und dafür braucht es keine weitere Föderalismusreform.
Sie sehen die Aufgaben also eher bei der Verwaltung und weniger beim Gesetzgeber?
Schröer: Wir haben schon viele gute Gesetze – auch wenn diese in Bezug auf die Bekämpfung sozialer Ungleichheit noch deutlicher sein könnten. Wir haben zudem die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen, wir haben die Kinderrechte der Vereinten Nationen. Es gibt aber ein massives Problem, das etwa an Schulen, in der beruflichen Bildung, an Universitäten und in der Kinder- und Jugendhilfe auch entsprechend umzusetzen. Die Probleme sind lange bekannt, die Frage ist, warum wir so wenig daran arbeiten, die sozialen Probleme zu lösen.
Hat Corona uns deutlicher gemacht, welche Probleme es gibt oder hat Corona unsere Gesellschaft auch verändert?
Allmendinger: Ich schließe mich da Heinz-Elmar Tenorth an, der von einer Refeudalisierung unserer Gesellschaft spricht. Wir werden einen großen Anstieg an Bildungsarmut sehen. Es ist ja gut ein Viertel der Kinder und Jugendlichen einfach ‚weggetaucht‘. Wir haben das zugelassen, obwohl wir früh Daten hatten, dass diese Zeit zuhause vollkommen unterschiedlich verbracht wird. Das ist auch nicht wirklich erstaunlich. In ein paar Jahren werden wir leider eine Situation vorfinden, die wir eigentlich vermeiden wollten. Bildung ist nun mal die beste Sozialpolitik und das Vehikel, um aus der Armut herauszukommen.
Schröer: Infrastrukturen merken wir ja vor allem dann, wenn sie nicht funktionieren. Über das Handy-Netz macht man sich ja vor allem Gedanken, wenn es ausfällt. Jetzt sehen wir, was passiert, wenn Bildungsstrukturen oder Angebote der Kinder- und Jugendhilfe wegbrechen. Dann kommt es zu einer Verstärkung der sozialen Unterschiede. Man darf daher nicht sagen: Wir bauen das erst wieder auf, wenn wir ökonomisch wieder auf die Beine gekommen sind. Das wäre die falsche Reihenfolge. Wir brauchen jetzt große Investitionen in eine Sozialpolitik für Kindheit und Jugend.
Allmendinger: Die Wissenschaft ist sich einig, dass wir ein Problem mit der Chancengerechtigkeit haben. Das hat sich noch verschärft. Wir reden jetzt wieder über ein Existenzminimum an Bildung. Was wir in Teilen sehen, ist ja eine Analphabetisierung. Das wird der ganzen Gesellschaft, also uns allen zu schaffen machen.
Wie könnte eine Post-Covid-Strategie aussehen, um wieder zu mehr Chancengerechtigkeit zu kommen? Müssen die Schüler*innen das jetzt in den Ferien aufholen?
Allmendinger: Wenn es so einfach wäre. Das sind ja keine Schulden, die man einfach abbauen kann. Ich habe überhaupt keine Hoffnungen, dass man diese Narben heilen kann. Natürlich braucht man Maßnahmen, aber ich habe Probleme, dass in die Sommerferien zu legen. Die Familien haben es ja auch verdient, mal wieder rauszukommen und sich von den Strapazen zu erholen. Aber wir müssten sofort flächendeckend mit individuellen Coaching-Programmen beginnen, wie es beispielsweise Hamburg jetzt macht. Dann sollten wir die Schulen, die es besonders schwer hatten, besser ausstatten. Dazu brauchen wir eine Bildungspolitik des Bundes, die das zu ihrer Sache macht und nicht alles auf Länder und Kommunen abwälzt.
Schröer: Es muss jetzt schnell gehandelt werden, vor allem an den berufsbildenden Schulen. Hier sind ja genau die jungen Menschen, die an einem mitunter schwierigen Übergang ins Arbeitsleben stehen. Dort stecken viele in Armutslagen. Hier braucht es so schnell wie möglich eine aufsuchende Jugendsozialarbeit, die mit diesen jungen Menschen ins Gespräch kommt. Ferienkurse mit Nachhilfeunterricht sind dagegen nur eine Idee, die bestimmte besorgte Eltern beruhigen soll. Die Kinder und Eltern, die jetzt besonders Hilfe brauchen, werden damit vermutlich gar nicht erreicht. Da sollte die Politik lieber schauen, wie die klassischen Ferienprogramme der Kinder- und Jugendarbeit gesichert werden kann, wo ja auch der BDKJ sehr aktiv ist. Wie kann ein Zeltlager stattfinden? Mit wie vielen Personen? Das müsste man erst mal wieder aufbauen und ermöglichen, bevor wir von Ferienkursen mit Nachhilfe sprechen.
Und was brauchen wir über den Sommer hinaus?
Schröer: Zudem brauchen wir eine Diskussion um eine eigenständige Sozialpolitik für Kinder und Jugendliche. Da müssen wir die Fragen stellen, die auch Frau Allmendinger angesprochen hat und schauen, wie wir einer möglichen – wenn man so will – Refeudalisierung entgegenwirken können. Diese strukturelle Frage muss sich die nächste Bundesregierung stellen. Zudem hat sich gezeigt, dass wir die Rechte von Kindern und Jugendlichen nicht wirklich ernst nehmen – dies ist ein Scheitelpunkt einer nachhaltigen Generationenpolitik. Über das Recht auf Bildung hat Frau Allmendinger schon gesprochen. Daneben gibt es auch das Recht auf politische Beteiligung. Das sieht man auch daran, dass in allen Phasen zuerst die Lehrer*innen, dann die Eltern und wenn überhaupt erst ganz zum Schluss die Schüler*innen befragt wurden, wie man die Probleme lösen könnte. Dabei ist das ein Grundrecht der jungen Menschen und so auch in der UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben.
Allmendinger: Das kann ich nur unterstreichen. Generell brauchen wir eine Grundsicherung für Kinder und Jugendliche. Dann brauchen wir eine Bafög-Reform und einen neuen Blick auf die berufsbildenden Schulen. Kindern und Jugendlichen muss endlich ihre Stimme gegeben werden und wir müssen ihnen auch zuhören.
Sie haben beide das Recht auf Beteiligung angesprochen. Der BDKJ fordert schon lange eine Absenkung des Wahlalters. Würde dies helfen, die Themen junger Menschen mehr in den Mittelpunkt zu rücken?
Allmendinger: Zumindest wäre das ein Druckmittel. Die Jugendlichen können heute mit 16 Jahren so viel. Warum sollen sie da nicht wählen dürfen? Wie können wir Erwachsenen sagen, die Jugendlichen hätten ja an nichts Interesse, wenn sie ihre Stimme gar nicht umsetzen können, um sich für ihre Interessen stark zu machen? Das ist eine Arroganz, die unverzeihlich ist. Gleichzeitig wird aber auch zu wenig getan, damit die relativ niedrige Wahlbeteiligung der jungen Wähler*innen ab 18 Jahren endlich steigt. Da liegt bereits ganz viel potenzielle politische Beteiligung brach, die man aktivieren könnte.
Schröer: Das ist längst überfällig. Grundsätzlich müssen ja eigentlich die Erwachsenen rechtfertigen, warum sie jungen Menschen dieses Recht oder andere Rechte vorenthalten. Aber das Wahlrecht ist nur die Spitze des Eisbergs. Wir brauchen insgesamt eine andere Kultur. Es muss selbstverständlich sein, dass Kinder und Jugendliche an Entscheidungen, die sie betreffen, auch beteiligt werden.
Jutta Allmendinger ist Direktorin des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB), das auch am Sechsten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung mitgearbeitet hat. Prof. Allmendinger ist eine der profiliertesten Soziologinnen Deutschlands.
Wolfgang Schröer ist Professor für Sozialpädagogik an der Universität Hildesheim und Vorsitzender des Bundesjugendkuratoriums, das die Bundesregierung in zentralen Fragen der Kinder- und Jugendpolitik berät.
Dieses Interview ist zuerst in der Zeitschrift bdkj.konkret (10/2021) erschienen. Wir bedanken uns bei unserem Mitgliedsverband, dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend – BDKJ, für die freundliche Genehmigung der erneuten Veröffentlichung des Interviews in unseren Jugendsozialarbeit News. Die gesamte Ausgabe der Zeitschrift können Sie hier lesen.
Quelle: BDKJ