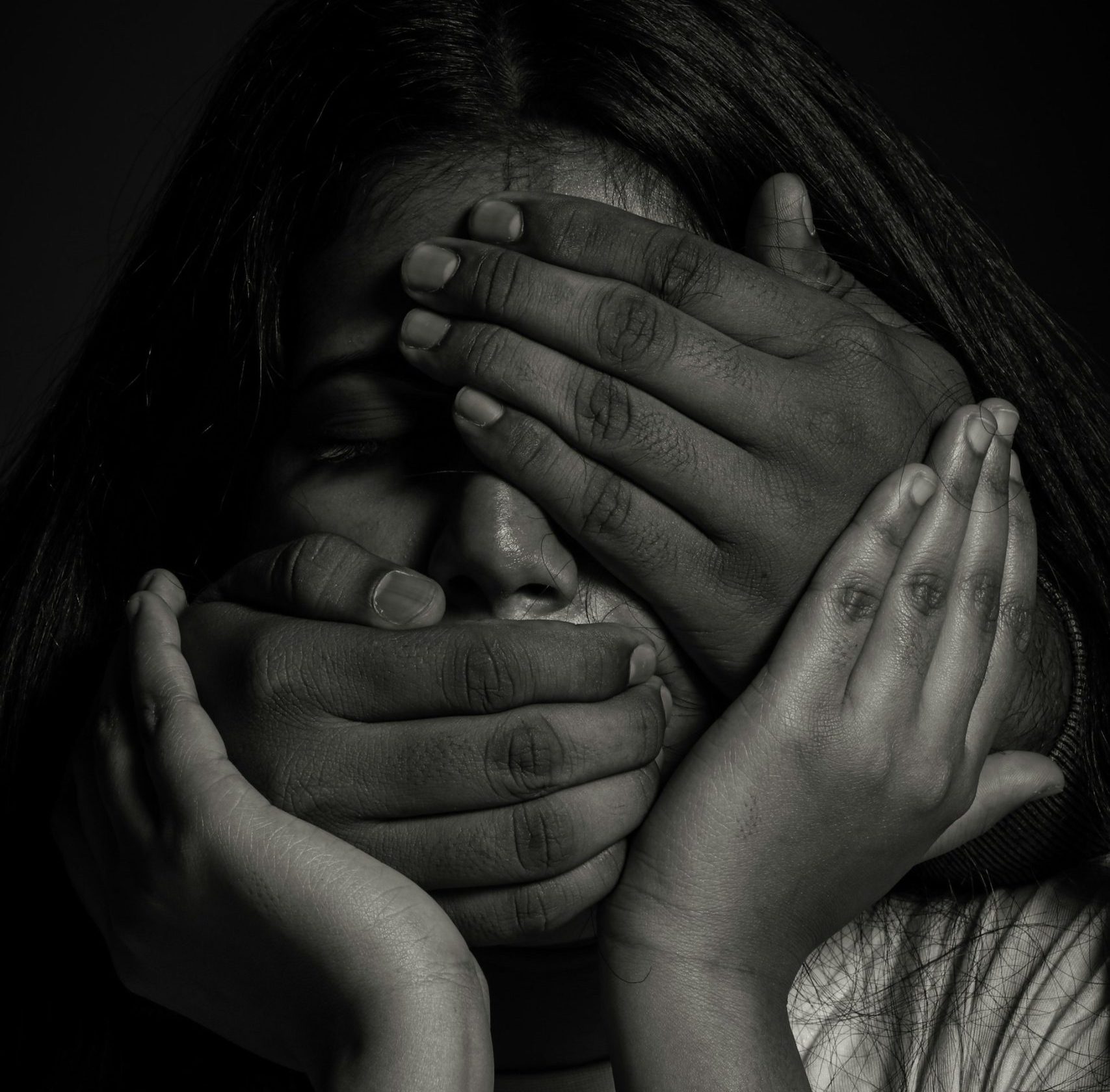Körpergefühl, Gewicht und Ernährung sind sensible Themen – besonders bei Kindern und Jugendlichen. Für den problematischen Umgang steht beispielhaft die Diskussion um den Hashtag #Skinnytok, der mittlerweile gesperrt wurde. Zuvor waren unter #Skinnytok Videos zu sehen, in denen häufig sehr schlanke Frauen Tipps zum Abnehmen gaben, Dünnsein mit Glücksgefühlen in Verbindung brachten und teilweise auch Essstörungen verharmlosten.
Bewegungen wie Body Positivity versuchen solchen gefährlichen Trends etwas entgegenzusetzen und zielen darauf ab, das eigene Selbstwertgefühl zu steigern. Sie rufen zur Bekämpfung unrealistischer Schönheitsideale und zur Selbstakzeptanz auf – ganz egal, ob man sich zu klein oder zu groß, zu dünn oder zu dick findet. Doch unabhängig von Schönheitsidealen und individuellem Wohlbefinden, gibt es beim Thema Ernährung und Gewicht den gesundheitlichen Aspekt.
Fokusanalyse Adipositas der DAK
In einer Sonderanalyse haben Wissenschaftler*innen von Vandage und der Universität Bielefeld Abrechnungsdaten von rund 800.000 bei der DAK-Gesundheit versicherten Kindern und Jugendlichen im Auftrag der Krankenkasse ausgewertet. Im Mittelpunkt der Fokusanalyse standen dabei die Fragen, wie viele der 5- bis 17-Jährigen zwischen 2018 und 2023 wegen Adipositas behandelt wurden und ob ein Zusammenhang zwischen der Erkrankung und der sozialen Herkunft der jungen Patient*innen besteht.
Die Daten belegen, dass im Jahr 2023 5,5 Prozent der Kinder aus von Armut betroffenen Familien wegen Adipositas in Behandlung waren. Dies traf hingegen nur auf vier Prozent der Kinder aus Haushalten mit höherem Einkommen zu. In Prozentpunkten mag das wenig erscheinen. Doch tatsächlich ist es eine Differenz von 36 Prozent. Bei den Mädchen war der Unterschied mit 3,8 zu 5,7 Prozent noch deutlicher ausgeprägt.
Einige Folgen davon zeigen sich unmittelbar, andere erst nach Jahren oder Jahrzehnten. Stark übergewichtige Kinder und Jugendliche verfügen häufig über eine geringe Ausdauer und werden bei Belastung schneller müde, sodass die Motivation für Bewegung sinkt. Zudem leiden Rücken und Gelenke unter zu hohem Gewicht. Langfristig gesehen erhöht sich durch Adipositas das Risiko für chronische Erkrankungen wie Bluthochdruck, Herzinfarkt, Typ-2-Diabetes, Schlafapnoe, Arthritis und Depressionen.
Ursachen und Lösungsansätze
Aufgrund der Art der ausgewerteten Daten gibt es in der Analyse keine Hinweise auf die Ursachen zwischen Gewicht und dem sozioökonomischen Hintergrund. Welche das sein können, hat die Bundesarbeitsgemeinschaft Arbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit (BAG KJS) bereits 2023 in ihrem Politikbrief „Jugend und Gesundheit“ aufgezeigt: Hohe Lebensmittelpreise, aber teilweise auch mangelndes Wissen, können einer ausgewogenen Ernährung im Weg stehen. Die Kinderärztin Dr. Kristina Kampmann vom Uniklinikum Essen formulierte damals in einem Interview mehrere Lösungsansätze. Sie umfassten hochwertige, kostenfreie Verpflegungsangebote in Kitas und Schulen, Ernährungserziehung für Kinder sowie -beratung für deren Eltern, steuerpolitische Maßnahmen, wie die Steuerbefreiung für Obst und Gemüse, sowie ein adäquater Regelbedarf für Lebensmittel in der Grundsicherung.
Das Praxisbeispiel Amsterdam
Diese Vorschläge machen deutlich, dass der Kampf gegen Adipositas kein individueller ist, sondern eine gesamtgesellschaftliche und politische Aufgabe. Was das konkret bedeuten kann, zeigt die Stadt Amsterdam mit dem A Healthy Weight for All Children–Programm seit 2013. Zu diesem Zeitpunkt war rund ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen in Amsterdam übergewichtig. Damit lag die Quote deutlich über dem landesweiten Schnitt von 13 Prozent. Um bis 2033 allen zwischen 0 und 18 Jahren ein gesundes Gewicht zu ermöglichen, wurde eine ganzheitliche Präventions- und Interventionsstrategie entwickelt, in der u. a. neben den Familien auch Schulen, Sportvereine, Beratungsangebote und das Gesundheitswesen involviert sind. Darüber hinaus umfasst dieses städtebauliche Maßnahmen, die Kindern Bewegung ermöglichen, und einfache Details wie öffentlich zugängliches und kostenloses Trinkwasser. Schon nach drei Jahren zeigten sich erste Erfolge. Die Anzahl der übergewichtigen und an Adipositas erkrankten Kindern und Jugendlichen sank um 12 Prozent, während der landesweite Prozentsatz gleich blieb.
In dem Politikbrief Jugend und Gesundheit der BAG KJS heißt es: „Eine Gesellschaft kann es sich nicht leisten, wenn es jungen Menschen als eine ihrer stabilen Säulen in Gegenwart und Zukunft nicht gut geht. Sie muss im eigenen Interesse dafür Sorge tragen, dass Kinder und Jugendliche gesund aufwachsen und starke Persönlichkeiten in einer solidarischen Gemeinschaft werden können.“ Das Beispiel aus Amsterdam unterstreicht, dass es sich lohnt, von Beginn an auf allen Ebenen in die Gesundheit junger Menschen zu investieren.
Autorin: Sandra Gärtner