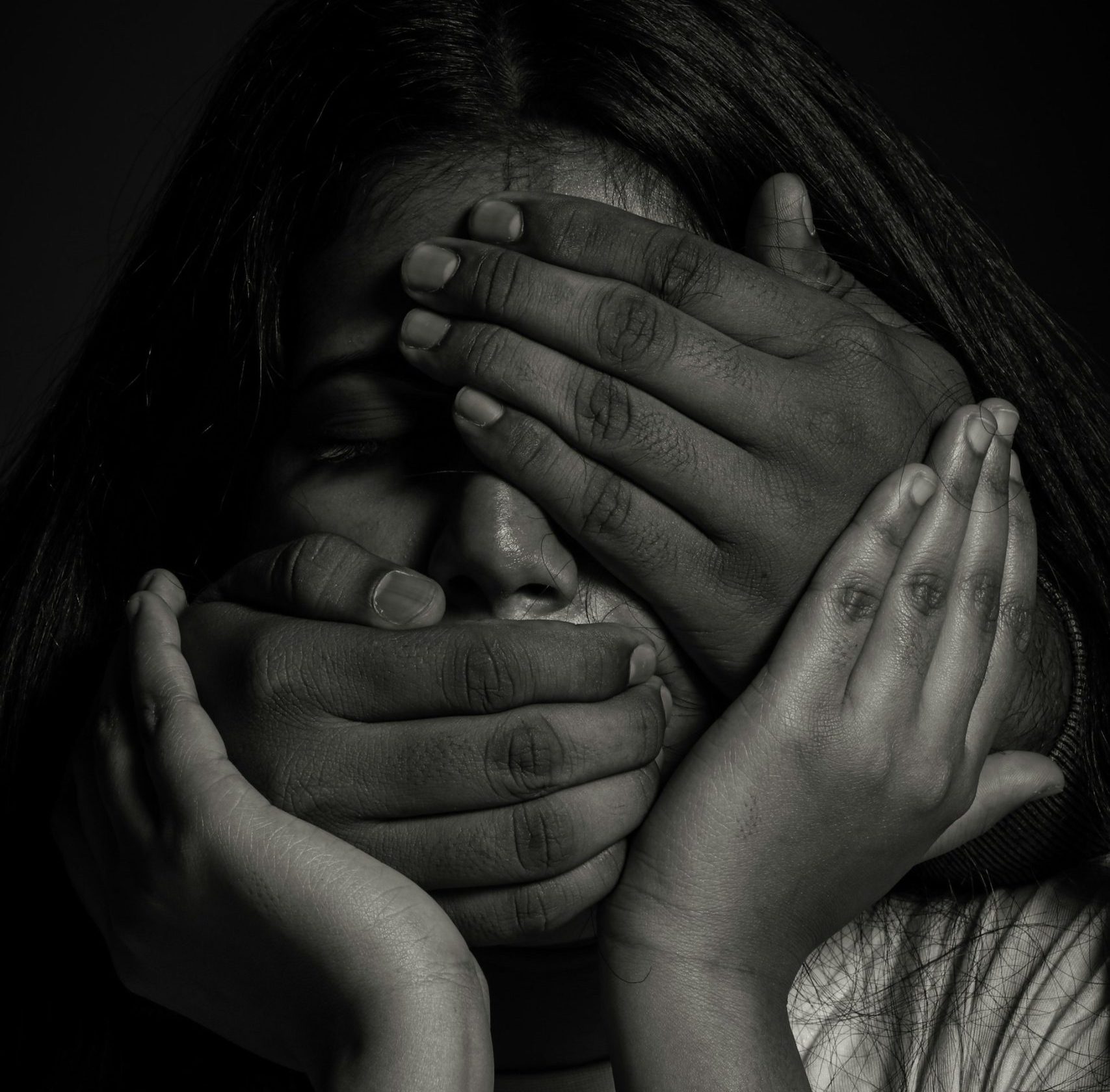Diskriminierung und Rassismus sind auch in Deutschland weit verbreitet, und betreffen direkt oder indirekt einen großen Teil der Bevölkerung. Deren Erfahrungen fallen jedoch nicht nur nach Bevölkerungsgruppe, sondern auch nach Art, Intensität, Häufigkeit und Diskriminierungsmerkmalen sehr unterschiedlich aus. Sie können sich negativ auf die Gesundheit der Betroffenen auswirken und zu einem nachweislichen Vertrauensverlust in staatliche Institutionen führen, wie der Nationale Diskriminierungs- und Rassismusmonitor (NaDiRa) 2023 des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM-Institut) belegt.
Mittels einer repräsentativen Befragung von mehr als 21.000 Personen und ergänzt durch qualitative Studien, hat der Bericht die Themen Gesundheit und Gesundheitsversorgung im Zusammenspiel mit Diskriminierung und Rassismus anhand von Diskriminierungserfahrungen von Menschen in Deutschland analysiert. Durch verschiedene Datenquellen soll der NaDiRa des DeZIM-Instituts dauerhaft verlässliche Informationen über Ursachen, Ausmaß und Folgen von Diskriminierung und Rassismus in Deutschland liefern. Auf dieser Grundlage sollen schließlich entsprechende Handlungsempfehlungen und effektive Maßnahmen gegen Rassismus abgeleitet und entwickelt werden. Die Datenlage zu Rassismus in Deutschland ist laut DeZIM-Institut bisher lückenhaft.
Im Mittelpunkt des Monitoringberichts 2023 stehen folgende Fragen: Wie hängen Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen und Gesundheit zusammen? Wer erfährt welche Art von Diskriminierung im Gesundheitswesen? Wie äußert sich dies und welche Folgen resultieren daraus? Die Ergebnisse spiegeln die Sichtweise der gesamten Bevölkerung wie auch die der unmittelbar von Rassismus Betroffenen wider.
Zentrale Ergebnisse
Laut Bericht sind allgemeine Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen in Deutschland weit verbreitet; wobei rassistisch markierte Personen überproportional oft davon betroffen sind. Insbesondere Menschen, die sich als Schwarz, muslimisch oder asiatisch identifizieren, gaben sehr viel häufiger als nicht rassistisch markierte Personen an, sowohl von subtilen als auch offenkundigen Diskriminierungen betroffen zu sein. Sie führten als Gründe für ihre Erfahrungen mehrheitlich Merkmale rassistischer Markierung wie Hautfarbe, Religion oder Deutschkenntnisse an. Den Daten des Berichts zufolge verschlechtert sich mit zunehmender Diskriminierungs- und Rassismuserfahrung sowohl die Gesundheitswahrnehmung als auch die psychische Belastung: Insbesondere jene, die regelmäßig Erfahrungen mit Diskriminierung und Rassismus machten, wiesen ein höheres Risiko auf, eine Angststörung oder Symptome von Depression zu entwickeln.
Die Herausgeber*innen des Berichts verweisen auch auf namensbasierte Diskriminierung beim Zugang zur Gesundheitsversorgung: Personen mit einem in Deutschland verbreiteten Namen erhielten deutlich häufiger positive Antworten auf ihre Terminanfragen als jene mit einem eher ausländisch klingenden Namen. Die Folge sei eine Ungleichbehandlung der Hilfesuchenden. Ausgenommen davon seien jedoch Kinder: Diese würden bei der Terminvergabe in Kinderarztpraxen gleichbehandelt, und es finde keine namensbasierte Diskriminierung statt.
Folgen von Diskriminierungserfahrungen für die Gesundheit
Von Rassismus betroffene Menschen gaben bei der Befragung häufiger als nicht Betroffene an, aus Angst vor Diskriminierung medizinische Versorgungsleistungen später oder teilweise gar nicht in Anspruch zu nehmen. Dies traf insbesondere auf von Rassismus betroffene Frauen zu. Von diesen gab knapp jede Dritte an, dass ihre Beschwerden nicht ernstgenommen würden und sie daher bereits den*die Ärzt*in wechseln mussten. Bei rassistisch markierten Männern war etwa ein Viertel betroffen.
„Wenn Beschwerden und Schmerzen nicht ernst genommen werden, kann dies zu Fehldiagnosen führen. In den Befunden zeigt sich diesbezüglich eine Norm des nicht rassistisch markierten Mannes. In Abgrenzung zu diesem wird allen anderen Gruppierungen das rassistische Stereotyp der Schmerzüberempfindlichkeit zugeschrieben. Sowohl Frauen – gleich ob rassistisch markiert oder nicht – als auch Männer, die rassistisch markiert sind, geben deutlich häufiger an, dass ihre Beschwerden nicht ernst genommen werden und ihnen unterstellt wird, mit ihren Beschwerden zu übertreiben“, stellen die Autor*innen des Berichts fest. Dieses Phänomen werde als „Morbus Aliorum“ (Krankheit der Anderen) bezeichnet. Frauen aller Gruppen seien davon im Besonderen betroffen, und einem höheren Risiko ausgesetzt, in der Folge eine inadäquate medizinische Versorgung zu erhalten.
Auch das Prinzip des „Othering“ – mittels Stereotypisierung als wesenhaft „Andere“ klassifiziert zu werden – führe zu Ausgrenzung, Abwertung und Benachteiligung. Folge davon könne ein Vertrauensverlust der Betroffenen in das Gesundheitssystem sowie die Verschlechterung ihrer Gesundheit sein. Bei Personen, die regelmäßig von Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen betroffen sind, nähmen zudem psychische Belastungen zu – oftmals in Form von Symptomen depressiver Erkrankungen und Angststörungen. Die Ungleichheitsmechanismen würden sich zudem gegenseitig dadurch verstärken, dass jede dritte rassistisch markierte Person angab, die Suche nach einer psychotherapeutischen Behandlung eher aufzugeben. Diese Personengruppe ist somit von der generellen Unterversorgung in diesem Bereich besonders betroffen.
Rassismus in der medizinischen Ausbildung
Die Autor*innen weisen zudem auf die rassistischen Wissensbestände in Lehrmaterialien der medizinischen Ausbildung und dessen mögliche Folgen für die Diagnostik und Behandlung hin. Rassistisch markierte Gruppen würden meistens weitgehend und systematisch nicht berücksichtigt. Im Falle einer Berücksichtigung würden sie hingegen oftmals als eine Abweichung von der (westlichen) Norm porträtiert. „Dabei werden sehr verschiedene Gruppen als „fremdartig“, „anders“ oder „besonders herausfordernd“ generalisiert. Gleichzeitig werden sie durch spezifische Zuschreibungen stereotypisiert und häufig mit bestimmten Krankheitsbildern (z. B. HIV oder Tuberkulose) oder Verhaltensweisen (z. B. Alkohol- und Drogenkonsum) verknüpft“, heißt es im Bericht. Das ärztliche Selbstbild erschwere dabei die Reflexion von Rassismus, konstatieren die Autor*innen: „Im Medizinstudium wird ein normatives Selbstbild der Ärzt*innenschaft gefördert, das sich in Abgrenzung zu einem stereotypisierten und exotisierten „Anderen“ oder „Fremden“ konstituiert.“
Fazit: Rassismus gefährdet die Demokratie
Erfahrungen mit Diskriminierung und Rassismus haben nicht nur konkrete Auswirkungen für die Betroffenen, sondern auch für die Gesamtgesellschaft: Ein Anstieg dieser Erfahrungen hänge direkt mit einem niedrigeren Vertrauen in Institutionen im Bereich der Gesundheitsversorgung als auch einem Vertrauensverlust in demokratische Strukturen zusammen. Doch eine Demokratie lebt von dem Vertrauen, das die Bürger*innen dem Staat und seinen Institutionen entgegenbringen. Wenngleich rassistisch markierte Personen ein generell höheres Grundvertrauen gegenüber den Institutionen in Deutschland – mit Ausnahme der Polizei und Justiz – als nicht rassistisch markierte Personen besäßen, werde dieses Vertrauen durch die Diskriminierungserfahrungen deutlich geschmälert. Besonders wenn Diskriminierungen in Institutionen stattfänden, die eigentlich zum Schutz der Bürger*innen und als Hilferäume dienten, könne das zu nachhaltigen, gravierenden Vertrauensverlusten führen, warnen die Herausgeber*innen des Berichts.
Diskriminierungen im Gesundheitsbereich müssten hierbei besonders beachtet werden, da Gesundheit nicht nur als Menschenrecht gelte, sondern speziell im Gesundheitsbereich Menschen meistens besonders vulnerabel und hilfsbedürftig seien. Erklärtes Ziel des Berichts sei somit eine gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Rassismus anzustoßen, um politische Maßnahmen zu entwickeln, die diesem nachhaltig entgegenwirken. Dafür bedürfe es auch kritischer Diskussionen, wie Rassismus in Deutschland adäquat erfasst und beforscht werden könne, resümieren die Forschenden.
Autorin: Mareike Klemz