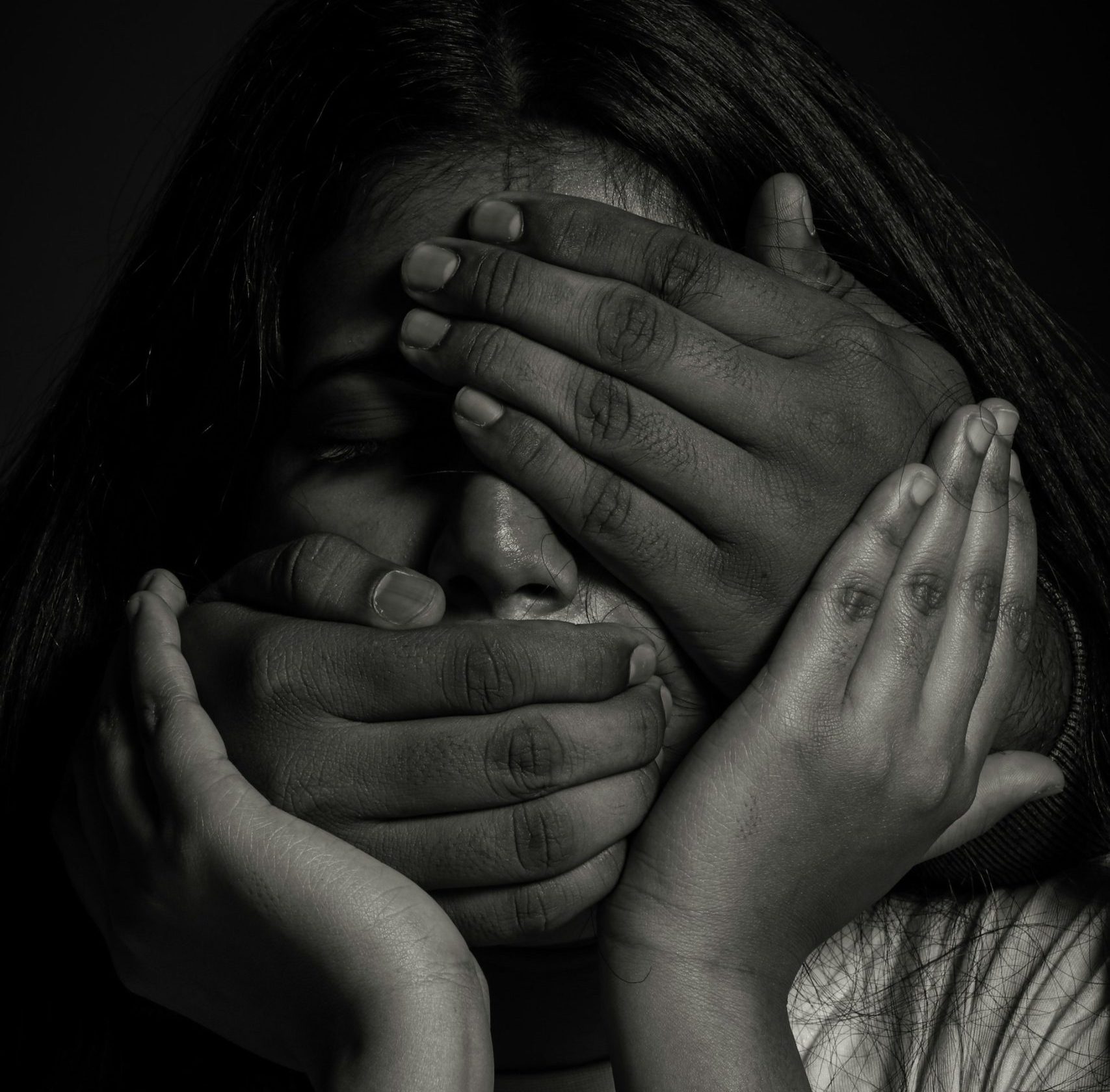Eine aktuelle Studie von Wissenschaftler*innen der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) belegt, dass Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung am effektivsten ihre Deutschkenntnisse ausbauen, wenn sie schnellstmöglich in regulären statt in separaten Schulklassen – sogenannten Willkommensklassen – integriert werden. Auch der erhoffte Nutzen dieser getrennten Klassen im Hinblick auf die Verbesserung der Sprachkenntnisse scheint sich nicht eindeutig zu bestätigen.
Für den schulischen Erfolg von Kindern und Jugendlichen mit Einwanderungsgeschichte ist ein erfolgreicher Spracherwerb der Landessprache eine wichtige Basis. Die Möglichkeiten, diese zu erlernen, werden durch die in Deutschland geltenden gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen bestimmt, insbesondere in den Bereichen Bildung und Asylpolitik.
Wie es um die Deutschkenntnisse jener jungen Geflüchteten steht, die zwischen 2015 und 2018 im Zuge der großen Fluchtmigrationsbewegung nach Deutschland gekommen sind, ist bislang wenig erforscht. Etwa ein Viertel der Asylsuchenden war damals minderjährig. Zudem gibt es bisher wenig wissenschaftliche Erkenntnisse, was den Zusammenhang zwischen den Zweitsprachenkenntnissen junger Geflüchteter und den politischen Instrumenten in der Migrations- und Bildungsgesetzgebung betrifft. Diese sind jedoch wichtig, um verstehen zu können, wie politische Maßnahmen die Ergebnisse der frühen Integration beeinflussen können – insbesondere den Erwerb einer Zweitsprache.
Aus diesem Grund haben die Forschenden PD Dr. Oliver Winkler von der MLU und Anne-Kathrin Carwehl vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Daten von mehr als 1.000 Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren ausgewertet. Zum Zeitpunkt der Befragung besuchten sie reguläre Klassen in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz oder Sachsen. Die Datengrundlage bildet das Panel „Refugees in the German Educational System“ (ReGES), das 2016 bis 2021 vom Leibniz-Institut für Bildungsverläufe durchgeführt wurde und auch die Deutschkenntnisse der Jugendlichen prüfte.
Im Mittelpunkt der Studie steht die Frage, ob unterschiedliche institutionelle Bedingungen – wie beispielsweise die Wartezeiten für die Einschulung, die Art der Klasse oder des Aufenthaltsstatus – einen Einfluss auf den individuellen Erwerb von Deutschkenntnissen der jungen Menschen hat. Dafür untersuchten die Studienautor*innen, ob die Einschulung, die Integration in Regelklassen anstelle separater Willkommensklassen und ein sicherer Aufenthaltsstatus in einem positiven Zusammenhang mit den Deutschkenntnissen junger Geflüchteter stehen.
Kernergebnisse
- Längere Wartezeiten korrelieren mit dauerhaft schwächeren Deutschkenntnissen: In vielen Bundesländern wird die Einschulung erst nach endgültiger kommunaler Zuordnung der Flüchtlingsfamilie vorgenommen, um häufige Schulwechsel zu vermeiden. Diese Praxis führt dazu, dass schulpflichtige Geflüchtete häufig mehr als ein halbes Jahr ohne regelmäßigen Kontakt zu deutschsprachigen Mitschüler*innen verbringen. Die durchschnittliche Wartezeit bis zur Einschulung beträgt etwa sieben Monate.
- Willkommensklassen erzielen nur begrenzte Fortschritte: Obwohl diese als Vorbereitung auf Regelschulklassen dienen sollen, konnten ehemalige Teilnehmende dieser Klassen selbst Jahre später keine vergleichbaren Sprachkompetenzen vorweisen wie Gleichaltrige, die von Anfang an regulär unterrichtet wurden. Die Daten deuten darauf hin, dass die vorbereitenden Maßnahmen das anfängliche Defizit nicht ausreichend ausgleichen können. Zwar gelten Vorbereitungsklassen als sicherer Ort, an dem ein schneller Spracherwerb ermöglicht sei, dennoch seien sie durchaus umstritten. Ihre Wirkung auf den Erwerb der deutschen Sprache sei zudem bisher nicht abschließend geklärt. Der mangelnde Kontakt zu gleichaltrigen Nichtgeflüchteten trage zudem dazu bei, dass Willkommensklassen kaum zu einer Angleichung der Zweitsprachkenntnisse führten.
- Der Asylstatus beeinflusst die Lernmotivation: Im Allgemeinen sind die Möglichkeiten zur Teilnahme am Schulunterricht rechtlich nicht vom Aufenthaltsstatus abhängig, da für Geflüchtete im schulpflichtigen Alter – einschließlich – geduldeter Kinder und Jugendlicher – in allen Bundesländern Schulpflicht besteht. Die Schulpflicht wird jedoch während des Asylverfahrens häufig ausgesetzt. Dennoch kann der rechtliche Status die Entscheidung von Einzelpersonen oder Familien beeinflussen, ob sie in Zweitsprachenkenntnisse investieren oder nicht. Die Bereitschaft, in den Erwerb einer Zweitsprache zu investieren, scheine bei Menschen mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus aufgrund der latenten Gefahr einer Abschiebung eher geringer auszufallen. Folglich wiesen Jugendliche, die mit einem latenten Abschiebe-Risiko lebten, tendenziell schlechtere Deutschkenntnisse auf.
Herausforderung verschiedener Zuständigkeiten
Die Studie weist auch auf die Hürden zwischen nationaler und regionaler bzw. lokaler Ebene und den damit einhergehenden verschiedenen Zuständigkeiten hin. Im Bereich der Bildung mache sich hierbei der Föderalismus und ein unterschiedlicher Umgang in den verschiedenen Bundesländern spürbar bemerkbar. „Während Institutionen oft Chancenstrukturen schaffen, können sie auch die Wahlmöglichkeiten und Handlungsfreiheit formell einschränken, indem sie Beschränkungen oder Regeln einführen“, führen die Forschenden aus. Zwar wird der Zeitpunkt der Einschulung von Asylsuchenden von den Bundesländern geregelt, was zu regionalen Unterschieden führt. Doch bestimmte Flüchtlingskohorten mussten aufgrund von Rückständen im Asylverfahren in den Jahren 2015/2016 besonders lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Dadurch verlängerten sich ihre Wartezeiten zusätzlich, bevor sie ihre Schulausbildung beginnen konnten. Nach Berücksichtigung des Ankunftsjahres und der jeweiligen Bundesländer stellten die Forschenden fest, dass der Zusammenhang zwischen längeren Wartezeiten und Zielsprachenkenntnissen statistisch signifikant blieb. Dies unterstreicht die Tatsache, dass eine eindeutige Gesetzgebung zum Schulzugang zur sprachlichen Integration beiträgt.
Fazit und Handlungsempfehlungen für die Politik
Aufgrund des Studiendesigns lässt sich laut den Forschenden keine endgültige Aussage darüber treffen, ob Vorbereitungsklassen als institutionelles Instrument der Bildungspolitik für die Bildungsintegration geeignet oder ungeeignet sind. Die unterschiedlichen Bildungssysteme der Bundesländer und ihre spezifischen bildungsbezogenen Rechtsvorschriften könnten zu zusätzlichen Unterschieden in den Zielsprachenkenntnissen der jungen Menschen beitragen. Zudem hänge der Bildungserfolg von Geflüchteten von zahlreichen Faktoren ab. Dennoch ließen sich Handlungsempfehlungen für die Politik ableiten. „Die Tendenz ist eindeutig: Eine möglichst schnelle Einschulung, eine rasche Integration in den Fachunterricht und ein sicherer Asylstatus sind gute Voraussetzungen für das Erlernen der deutschen Sprache. Insbesondere in den Grundschulen sollte auf separierende Vorbereitungsklassen verzichtet werden“, sagt Winkler. Es gelte seitens der Politik, gute Rahmenbedingungen und kontinuierliche Unterstützung für eine gelingende Integration zu schaffen, sagt der Wissenschaftler.
Autorin: Mareike Klemz