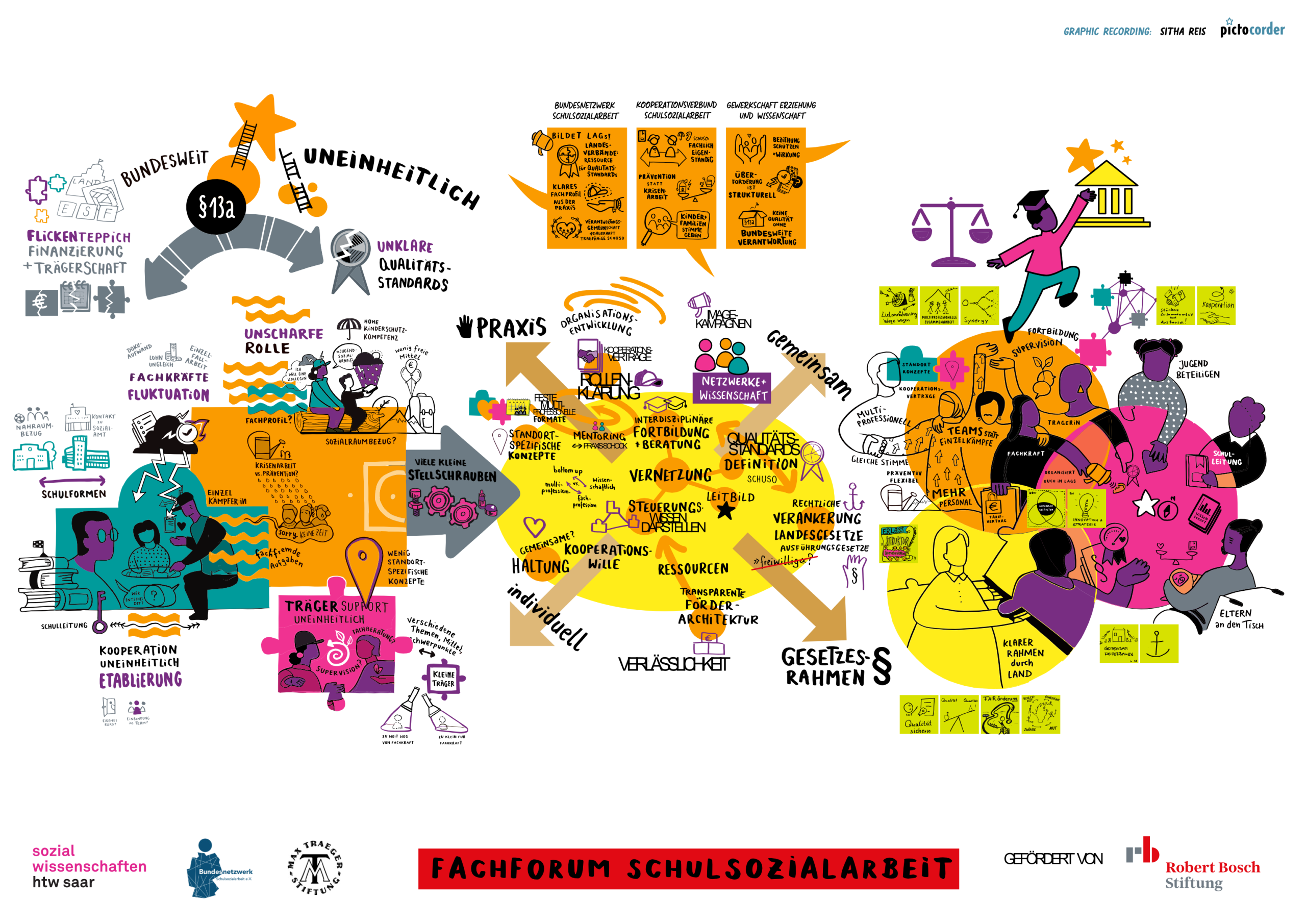Stimmen aus Wissenschaft, Praxis und Schülerschaft machen deutlich, welchen Beitrag die Mental Health Coaches im Schulalltag leisten – und weshalb feste Strukturen und Ansprechpersonen für mentale Gesundheit unverzichtbar sind.
Wie geht es jungen Menschen heute – und was brauchen sie, damit Schule ein Ort wird, der sie stärkt, statt zusätzlich zu belasten? Die Videokampagne zum Modellprogramm „Mental Health Coaches“(MHC) nimmt diese Fragen auf und knüpft an den Fachtag „Mental Health weiterdenken – Was junge Menschen stärkt“ an, der Mitte Oktober 2025 in Berlin stattgefunden hat. In kurzen Clips kommen Wissenschaft, Mental Health Coaches, Programmkoordination und die Bundesschülerkonferenz zu Wort und machen sichtbar, welche Belastungen den Alltag von Schüler*innen prägen, welche Unterstützung sie sich wünschen, welchen Beitrag das Programm im Schulalltag leistet – und warum seine Fortführung für viele Schulen so wichtig ist.
Die fünf Videoclips wurden im Laufe der vergangenen eineinhalb Wochen auf den Social-Media-Kanälen der BAG KJS veröffentlicht. Sie knüpfen an die Aktivitäten im Oktober rund um den Welttag der mentalen Gesundheit und die Aktionswoche Seelische Gesundheit an und setzen somit die Debatte über mentale Gesundheit junger Menschen konsequent fort.
Wissenschaftliche Perspektive: Bedeutung niedrigschwelliger Angebote
Prof. Dr. Claudia Calvano, Professorin für klinische Kinder- und Jugendpsychologie und Leiterin der Psychotherapeutischen Hochschulambulanz für Kinder und Jugendliche der Freien Universität Berlin ordnet die Rolle der Mental Health Coaches aus fachlicher Sicht ein. Sie macht deutlich, dass es in Deutschland erstmals – wenn auch noch nicht flächendeckend – ein systematisches Angebot zur psychischen Gesundheit direkt an Schulen gibt. An vielen Pilotstandorten seien damit Anlaufstellen entstanden, an die sich belastete Kinder und Jugendliche im Schulalltag wenden können. Der in den vergangenen Jahren immer lauter gewordene Ruf nach Unterstützungsangeboten im System Schule findet damit eine konkrete Antwort. Entscheidend ist für Calvano, dass es sich um niedrigschwellige Angebote handelt, „die für alle erreichbar sind“ und bei denen je nach Bedarf geschaut werden kann, welche Form von Hilfe nötig ist. Die Videokampagne macht so sichtbar, dass Mental Health Coaches ein wichtiges Element in einer präventiven Versorgungsstruktur sind.
Stimme der Schülerschaft: Mehr Ansprechpersonen und klare Konzepte
Stellvertretend für die Sicht der Schüler*innen kommt Quentin Gärtner, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, zu Wort. Er fordert eine Schulkultur, in der mentale Gesundheit aktiv thematisiert wird und feste Ansprechpersonen jenseits des Unterrichts strukturell verankert sind. Dazu zählen für ihn Schulsozialarbeiter*innen, Schulpsycholog*innen und Mental Health Coaches, die vor Ort sind, wenn es jungen Menschen nicht gut geht.
Gärtner betont, dass psychische Belastungen nur dann aufgefangen werden können, wenn sichtbar wird, wie es Jugendlichen tatsächlich geht. Ohne klare Konzepte, verlässliche Anlaufstellen und Räume, in denen offen über Themen wie Depression, Mobbing oder Einsamkeit gesprochen werden kann, bestehe die Gefahr, „dass wir die Leute nur verlieren“ – daher fordert Gärtner, dass junge Menschen die Hilfe erhalten, die sie benötigen. Mit Blick auf die Kampagne „Uns geht’s gut?“ der Bundesschülerkonferenz verweist er auf alarmierende Zahlen: Mehr als jede*r vierte Schüler*in beschreibt die eigene Lebensqualität als gering. Aus seiner Sicht macht dies deutlich, dass die Krise der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen politische Konsequenzen haben muss und wirksame Maßnahmen erforderlich sind.
Arbeit der bundesweiten Fachkräfte: Unterstützung im Schulalltag – und darüber hinaus
Die beiden Videoclips mit den Mental Health Coaches, den Fachkräften vor Ort, verdeutlichen, wie das Programm im Schulalltag greift. Die Mental Health Coaches verstehen sich als Teil multiprofessioneller Teams und erweitern den Blick der Schulen konsequent um das Thema mentale Gesundheit. Sie betonen, dass es nach wie vor in der Gesellschaft zu wenig niedrigschwellige Angebote gibt – ein besonderer Vorteil des Programms ist daher, dass es direkt im Setting Schule ansetzt, wo alle Schüler*innen erreicht werden können.
Die Fachkräfte im Programm erläutern ihr konkretes Vorgehen. Als niedrigschwellige Anlaufstelle sprechen sie mit Jugendlichen über ihre Ängste, und Sorgen und tragen dazu bei, das Reden über Gefühle zu entstigmatisieren. Darauf aufbauend holen sie die Sicht der Lehrkräfte auf die Klasse ein und entwickeln bedarfsorientierte Gruppenangebote, in denen es darum geht, ins Gespräch zu kommen, gemeinsam Strategien im Umgang mit Belastungen und Stress zu erarbeiten und Erfahrungen miteinander zu teilen.
Ergänzend dazu binden die Mental Health Coaches weiteres Fachpersonal ein, zum Beispiel Achtsamkeitstrainer*innen. Diese unterstützen die Schüler*innen dabei, eigene Bewältigungsstrategien zu entwickeln und im Alltag anzuwenden. So werden Schulen Schritt für Schritt zu Lernorten, in denen nicht nur fachliche, sondern auch emotionale Kompetenzen gestärkt werden.
Programmkoordination: Ruf nach verlässlichen Strukturen
Im Hinblick auf die Wirkung des Programms aus wissenschaftlicher Sicht zieht Özlem Tokyay, Programmkoordination des MHC-Programms bei der BAG KJS ein Resümee. Aus ihrer Sicht ist besonders bedeutsam, dass junge Menschen die Angebote der Mental Health Coaches sehr gut annehmen. Viele Schüler*innen suchten bewusst die Räume auf, in denen sie über Belastungen und Sorgen sprechen können. Auf diese Weise seien die Coaches an vielen Standorten zu vertrauten Bezugspersonen geworden.
Für Tokyay zeigt dies, dass niedrigschwellige Zugänge im Setting Schule funktionieren und mentale Gesundheit genau dort verankert sein sollte. Gleichzeitig macht sie auf den hohen Bedarf aufmerksam: Rund 80 Prozent der Schulen, die bisher nicht am Programm beteiligt sind, wünschen sich ebenfalls eine*n Mental Health Coach*in. Damit rückt die Frage nach verlässlichen Strukturen in den Vordergrund – Strukturen, „die Kontinuität versprechen und auf die sich junge Menschen verlassen können“ so Tokyay.
Die Videokampagne verweist zudem auf die fachliche Grundlage des Programms: Die enge Vernetzung von Wissenschaft und Praxis, ein bundesweites Netzwerk zu Wissenschaftler*innen und Hilfestrukturen sowie die kontinuierliche Qualifizierung der Fachkräfte sorgen dafür, dass Erfahrungen ausgewertet und zielgruppenorientiert weitergegeben werden. Die bundesweite Anbindung des Programms fördert so den Wissenstransfer und trägt zu einer nachhaltigen Wirkung bei.
Deutlich wird durch die Videos somit, wie Mental Health Coaches dazu beitragen, auf die vielfältigen Belastungen junger Menschen zu reagieren und niedrigschwellige Unterstützung im Alltag bereitzustellen. Entscheidend wird nun sein, ihre Arbeit in verlässliche Strukturen zu verankern – für eine Zukunft, in der mentale Gesundheit selbstverständlich zum Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen gehört.
Autorin: Ilka Bähr