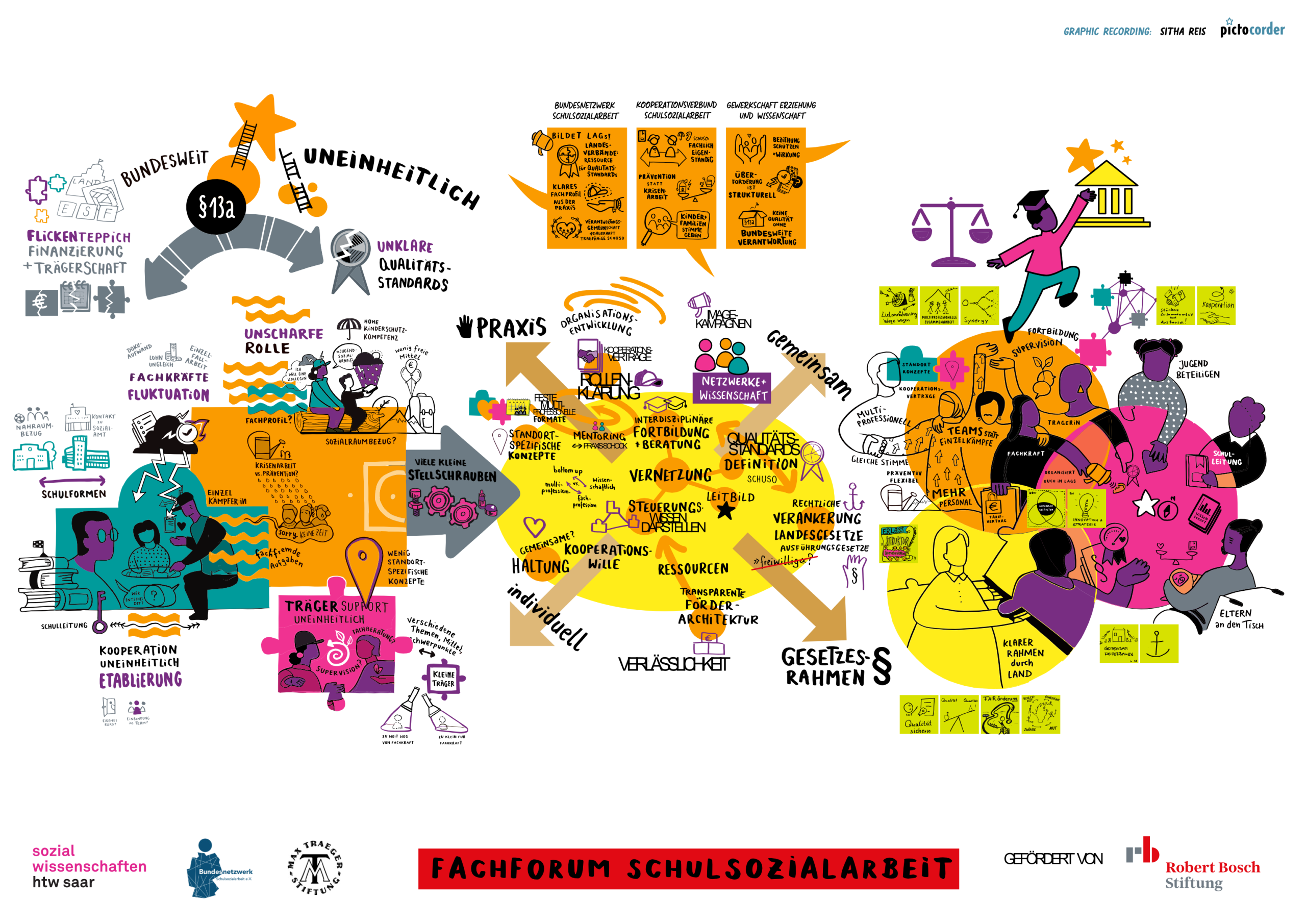Jugendberufsagenturen (JBA) sollen jungen Menschen beim Übergang von der Schule in Ausbildung und Beruf zur Seite stehen – unabhängig davon, welcher Rechtskreis zuständig ist. Doch in der Praxis hakt es noch an vielen Stellen. Ein Impulspapier der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) sowie eine begleitende Fachveranstaltung haben kürzlich zentrale Herausforderungen und notwendige Entwicklungsschritte für JBA in den Fokus genommen. Aus Sicht der Jugendsozialarbeit werden viele der seit Langem diskutierten Bedarfe aufgegriffen, insbesondere mit Blick auf junge Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf. Denn gerade für sie sind verlässliche, koordinierte und passgenaue Angebote am Übergang Schule-Beruf besonders wichtig.
Rechtskreisübergreifend – aber nicht gemeinschaftlich?
Die Idee der Jugendberufsagentur ist gut: Junge Menschen sollen im Sinne eines „One-Stop-Government“ gemeinsam von der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter und dem Jugendamt beraten und begleitet werden. Doch genau hier liegt oftmals das Problem: Da die Kooperation auf Freiwilligkeit basiert, bleibt sie vielerorts eine strukturelle Hülle. Es fehlt nicht nur an verbindlichen rechtlichen Grundlagen, sondern vor allem an einem gemeinsamen, rechtskreisunabhängigen Budget. Drei Rechtskreise – SGB II, III und VIII – treffen aufeinander, aber oftmals fühlt sich niemand für das große Ganze verantwortlich. Dies führt häufig zu Parallelstrukturen, unklaren Zuständigkeiten und der Gefahr, dass junge Menschen keine passgenaue Unterstützung erhalten.
Die fehlende gemeinsame Finanzierung ist in der Praxis häufig hinderlich, wenn es darum geht, gemeinsame Räume anzumieten oder Personal einzustellen, das rechtskreisübergreifend für die Koordination verantwortlich ist. Entscheidungen werden weiterhin innerhalb der jeweiligen Rechtskreise getroffen, mit teils widersprüchlichen Zielvorgaben, Handlungslogiken und Werthaltungen. Junge Menschen erleben diese Strukturen als unübersichtlich und schwer zugänglich. Gerade diejenigen, die ohnehin auf Unterstützungsbedarf angewiesen sind, benötigen jedoch Kontinuität, Klarheit und Verlässlichkeit.
Keine Qualität ohne Standards
Wie gut eine JBA funktioniert, hängt vielerorts eher vom Engagement einzelner Personen als von einheitlichen Standards ab. Die FES fordert für die Arbeit von Jugendberufsagenturen klare Qualitätskriterien. Diese müssen sich an den Bedürfnissen junger Menschen orientieren, insbesondere derer, die von sozialer Benachteiligung betroffen oder in besonderer Weise beeinträchtigt sind. Dazu bedarf es eines niedrigschwelligen, erreichbaren, lebensweltbezogen und vertrauensvollen Settings, das die jungen Menschen dort abholt, wo sie stehen.
In der Fachveranstaltung zur Veröffentlichung des Impulspapiers wurde deutlich: Nicht nur organisatorische Veränderungen oder ein einheitlicher Markenauftritt sind wichtig, sondern eine gemeinsame Haltung und ein verbindliches Selbstverständnis der Zusammenarbeit. Notwendig sind gemeinsame Qualitätsstandards, verbindliche Vereinbarungen und die Bereitschaft, sich über institutionelle Grenzen hinweg auf ein gemeinsames Ziel zu verständigen.
Die Wirkung nach außen: Warum das Erscheinungsbild der JBA zählt
Ein weiteres Thema, das sowohl in der Fachveranstaltung als auch im Impulspapier zur Sprache kam, ist das fehlende einheitliche Branding der Jugendberufsagenturen. Bisher werden JBA vielerorts als Anlaufstellen in Krisen wahrgenommen. Dabei sollen sie eigentlich für alle jungen Menschen offenstehen, unabhängig von ihrer sozialen oder schulischen Ausgangslage.
Aus Sicht der Jugendsozialarbeit ist ein einheitliches, inklusives und für junge Menschen ansprechendes Erscheinungsbild der Jugendberufsagenturen ein zentraler Hebel, um Stigmatisierung entgegenzuwirken. JBA sollten als selbstverständliche Anlaufstelle für alle jungen Menschen am Übergang Schule-Beruf erlebbar und zugänglich sein. Hiervon profitieren besonders von Benachteiligung und Beeinträchtigung Betroffene, die nicht mehr als „Problemfälle“ wahrgenommen werden.
Jugendhilfe innerhalb der JBA stärken
Ein Aspekt, der weder im Impulspapier noch in der Fachveranstaltung explizit benannt wurde, aus Sicht der Jugendsozialarbeit jedoch zentral ist: Die Jugendhilfe muss als gleichwertiger Partner innerhalb der Jugendberufsagenturen gestärkt werden.
Damit Jugendberufsagenturen ihrem Anspruch gerecht werden, jungen Menschen ganzheitliche Unterstützung anzubieten, reicht die formale Zusammenarbeit der Rechtskreise SGB II, SGB III und SGB VIII nicht aus. In der Praxis bleibt die Beteiligung der Jugendhilfe häufig schwach ausgeprägt, ihre Angebote sind institutionell oft nicht gleichberechtigt vertreten.
Dabei sind es gerade die sozialpädagogischen Kompetenzen der Jugendhilfe, die im Umgang mit jungen Menschen in herausfordernden Lebenslagen entscheidend sind. Eine Stärkung des SGB VIII innerhalb der JBA ist keine Option, sondern eine notwendige Voraussetzung für gelingende Übergänge.
Einbindung der freien Träger der Jugendhilfe
Ein weiteres zentrales Anliegen aus Sicht der Jugendsozialarbeit: Die Angebote der freien Träger der Jugendhilfe müssen systematisch in die Arbeit der JBA eingebunden werden. Seit Jahren leisten diese Einrichtungen eine erfolgreiche, beziehungsorientierte Arbeit mit jungen Menschen. Der Umgang mit komplexen Lebenslagen, eine niedrigschwellige Erreichbarkeit und Vertrauen bei jungen Menschen, die sich institutionellen Angeboten häufig entziehen, sind hier bereits gegeben. Diese Ressourcen müssen konsequent genutzt und nicht nur als Ergänzung verstanden werden.
Aktuell wird das Potenzial dieser Strukturen zu wenig ausgeschöpft. Häufig fehlen verbindliche Schnittstellen und tragfähige Kooperationen. Dabei wäre eine strukturelle Einbindung der freien Träger ein echter Gewinn: Sie bringen Perspektiven ein, die über die reine Vermittlungslogik hinausgehen und stellen die lebenslagenorientierte, ganzheitliche Unterstützung in den Mittelpunkt.
Im Impulspapier wird bereits die Zusammenarbeit von JBA mit Partnern und Gremien der beruflichen Bildung genannt. Hierbei dürfen die freien Träger der Jugendhilfe nicht vergessen werden. Es braucht politische und administrative Weichenstellungen, etwa in Form verbindlicher lokaler Kooperationsvereinbarungen oder der institutionellen Beteiligung freier Träger an Steuerungsgremien. Ziel muss die gemeinsame Verantwortungsgemeinschaft aller relevanten Akteure auf Augenhöhe sein.
Fazit: Zusammenarbeit auf Augenhöhe jetzt verbindlich gestalten
Jugendberufsagenturen können ein zentraler Baustein für gelingende Übergänge junger Menschen in Ausbildung und Arbeit sein. Doch dafür braucht es mehr als das organisatorische Nebeneinander dreier Rechtskreise. Aus Sicht der Jugendsozialarbeit ist klar: Notwendig sind verbindliche Strukturen statt freiwilliger Kooperation, gemeinsame Verantwortung statt isolierter Zuständigkeiten und vor allem eine konsequente Beteiligung der Jugendhilfe auf Augenhöhe.
Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, werden Jugendberufsagenturen ihrem Anspruch gerecht, alle jungen Menschen wirksam zu begleiten – auch und gerade jene, die von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen sind. Wer Chancengleichheit will, muss jetzt handeln – und die Jugendhilfe und die Jugendsozialarbeit dabei nicht als nachrangige Akteure, sondern als gestaltende Kräfte im Übergangssystem ernst nehmen.
Weiterführende Literatur:
- Berghaus et al. 2024: „Jugendberufsagentur im Fokus – Grundlegende Aspekte der rechtskreis- und fachübergreifenden Zusammenarbeit“ (Servicestelle Jugendberufsagenturen)
- Beierling et al. 2024: „Jugendberufsagenturen als Beitrag zu inklusiver Übergangsgestaltung zwischen Schule und Beruf“ (Bundesinstitut für Berufsbildung)
- Burmeister 2021: „Jugendberufsagenturen – Ursprung und Entwicklungsperspektive“
- Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit 2021: „Positionspapier: Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit fordert Jugendberufsagenturen jugendgerecht zu gestalten“
Autorin: Sarah Mans (Fachreferentin Jugendberufshilfe der LAG KJS NRW im Netzwerk der BAG KJS)