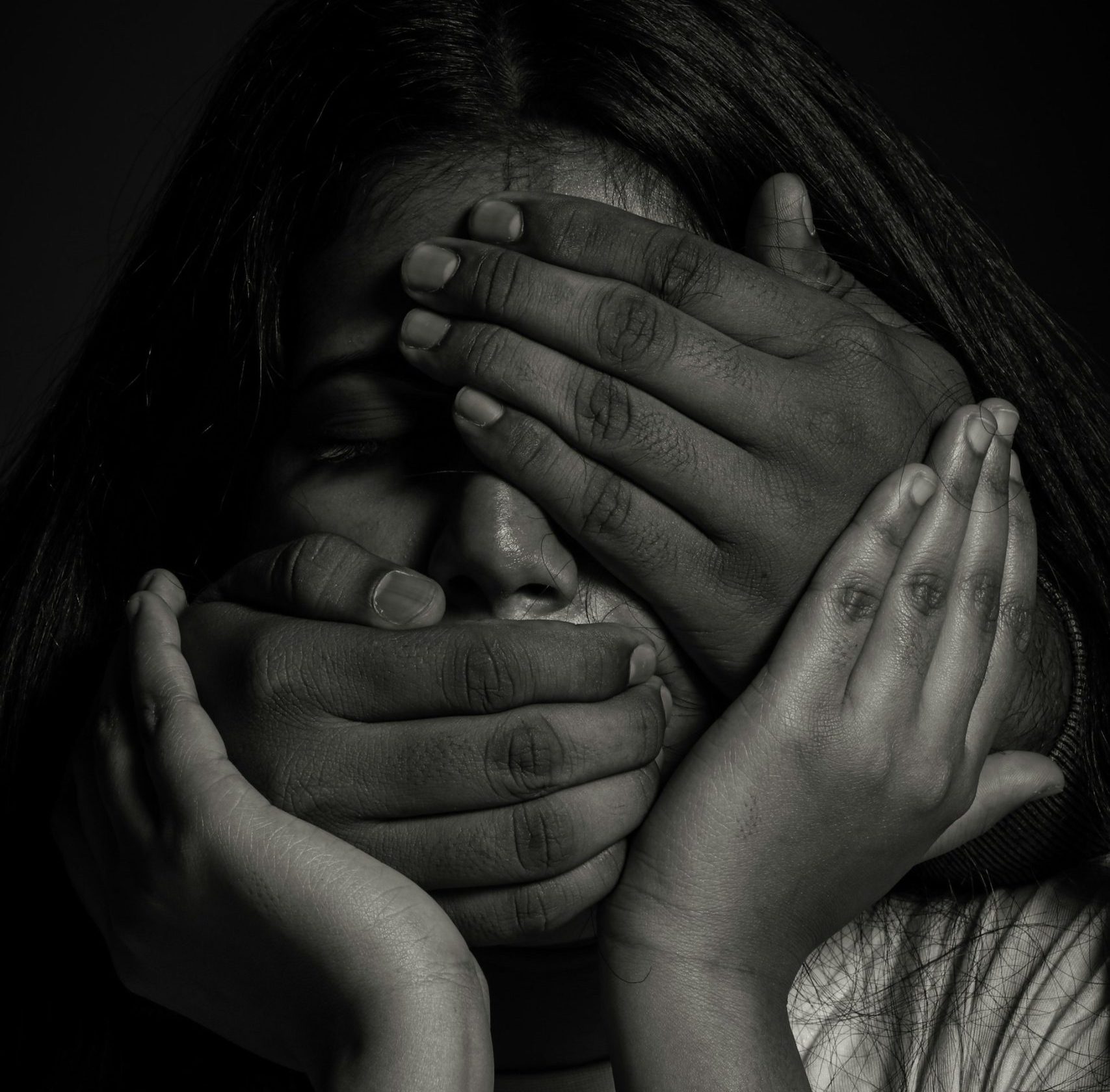Im Rahmen unserer Interviewreihe „Schulabsentismus begegnen – aber wie?!“ wird monatlich ein ausgewähltes Praxisbeispiel aus der Jugendsozialarbeit vorgestellt. Fachkräfte der einzelnen Angebote geben Einblick in ihre Arbeit und zeigen Herausforderungen sowie die aus ihrer Sicht maßgeblichen Gelingensbedingungen auf. Im Mittelpunkt stehen dabei Projekte und Maßnahmen, die junge Menschen individuell begleiten und sie darin unterstützen, ihren Weg zurück ins Bildungssystem oder gegebenenfalls einen alternativen Bildungsweg zu finden – mit dem Ziel, ihnen gesellschaftliche Teilhabe (wieder) zu ermöglichen. Die Gesprächspartner*innen sind Teilnehmende des Projektes „Schule – ohne mich!? Neue Entwicklungen und Handlungsanforderungen bei Schulabsentismus“ von IN VIA Deutschland im Netzwerk der Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit.
Für diese Ausgabe der Interviewreihe sprach Katrin Dreher (TRIAS Koordinatorin Regionen Herrenberg/ Gäu / Schönbuch / Stadt Leonberg und Renningen) von der Waldhaus Jugendhilfe mit den Jugendsozialarbeit News.
Wie zeigt sich das Phänomen Schulabsentismus in Ihrer Region?
Katrin Dreher: Schulabsentismus – das unentschuldigte Fehlen im Schulunterricht – ist ein Phänomen, das in den letzten Jahren stetig zugenommen hat und mittlerweile zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem geworden ist. Eine Datenauswertung des SWR Data Lab zeigt, dass im Landkreis Böblingen 8,3 Prozent der über 15-Jährigen im Jahr 2022 keinen Schulabschluss erreicht haben (26.920 Personen). Im Vergleich dazu liegt der Bundesdurchschnitt bei 6,9 Prozent. In Baden-Württemberg haben 7,7 Prozent der Schüler*innen über 15 Jahre keinen allgemeinbildenden Schulabschluss. Ursachen von schulaversiven Verhalten sind vor allem psychische Störungen, Überforderungssituationen sowohl der Schüler und Schülerinnen selbst als auch ihrer Eltern, und Trennungsängste.
Bereits im Aufnahmegespräch geben mittlerweile ca. 67 Prozent der Kinder und Jugendlichen an, verschiedene Ängste in der Schule zu haben. Die Ängste beeinträchtigen die Kinder und Jugendliche teilweise so stark, dass ein Schulbesuch nicht mehr oder nur eingeschränkt an bestimmten Tagen möglich ist. Aufgrund dieser starken Angstthematik, welche oftmals mit depressiven Verstimmungen verbunden ist, ist die Verweildauer bei TRIAS deutlich gestiegen. Wege aus der Angst zu finden und die betroffenen Kinder und Jugendlichen anschließend zu stabilisieren und zu reintegrieren, bedeutet einen langen, sowie hohen Betreuungsaufwand. Durch lange Wartezeiten in der PIA (Psychiatrische Institutsambulanz), bei Therapeut*innen, bei Psychiater*innen, bei Beratungsstellen und auch bei den HzE-Maßnahmen (Hilfen zur Erziehung) des Jugendamtes, überbrücken wir im Rahmen von TRIAS diese Wartezeiten und sind in dieser Zeit oftmals die einzige Unterstützung für die Familien.
Durch die aufsuchende Tätigkeit ist es möglich die Kinder und Jugendlichen, die unter psychischen Problemen leiden, nicht noch zusätzlich durch weite Wege zu belasten. Auch die in der Vergangenheit aufgebaute sehr gute Kooperation mit den Mitarbeiter*innen der Kinder- und Jugendpsychiatrie Böblingen und der schulpsychologischen Beratungsstelle erleichtert und beschleunigt die Diagnostik, von der im Vorfeld die Eltern, wie auch die Schüler*innen, oft erst noch überzeugt werden müssen. Dies kann nur durch eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Teilnehmer*innen und deren Eltern erreicht werden.
Bindungsthematiken und Ablösungsprozesse von den Eltern sind vor allem bei Schülerinnen und Schülern in der Grundschule ein vorrangiges Thema. Auch psychisch erkrankte Eltern bedürfen unserer großen Aufmerksamkeit und Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags.
Wo setzt Ihr Projekt bzw. Ihr Angebot an?
Katrin Dreher: Das Projekt TRIAS widmet sich als Angebot der Kinder- und Jugendhilfe der sozialpädagogischen Begleitung von Schülerinnen und Schülern, die die Schule trotz geltender Schulpflicht nicht mehr besuchen. Der Name TRIAS leitet sich aus der Dreierbeziehung (von griechisch triádos = Dreiheit) zwischen Familie, Schule und Jugendhilfe ab.
TRIAS wird von drei freien Trägern der Jugendhilfe im gesamten Landkreis Böblingen umgesetzt. Die Stiftung Jugendhilfe aktiv ist für die Schulen der Region Stadt Böblingen, Ehningen, Dagersheim und Aidlingen zuständig. Mevesta e.V. für die Schulen der Region Sindelfingen, Weil der Stadt, Rutesheim und Weissach. Die Waldhaus gGmbH, für die ich tätig bin, ist Ansprechpartner für die Schulen der Region Herrenberg, Gäu, Schönbuch, der Stadt Leonberg und Renningen.
Das Projekt TRIAS versteht sich als Ergänzung zu den Angeboten und Aufgaben der Schulsozialarbeit und der Jugendhilfe des Jugendamtes. Wenn die Notwendigkeit für eine intensive Einzelfallhilfe gegeben ist und die Möglichkeiten der Schulsozialarbeit erschöpft sind, kann TRIAS weitere Unterstützung anbieten. Es können durch die Mitarbeitenden von TRIAS nur Kinder und Jugendliche unterstützt werden, die eine Schule im Landkreis Böblingen besuchen und auch im Landkreis wohnhaft sind. Ziel der Begleitung durch TRIAS ist die Reintegration der Schülerin bzw. des Schülers in den Regelbetrieb der Schule.
In enger Kooperation mit den Schulen, der Schulsozialarbeit und – bei Bedarf – mit dem Jugendamt Böblingen, entwickelt TRIAS individuelle Unterstützungsangebote für die Schüler*innen und ihre Eltern. Zudem kooperiert TRIAS eng mit weiteren Netzwerkpartnern des Landkreises Böblingen. Zu diesen gehören u. a. das Schulamt, die schulpsychologische Beratungsstelle, Kinder- und Jugendpsychotherapeut*innen, die Kinder- und Jugendpsychiatrie mit kinderpsychiatrischer Tagesklinik, die Polizei, die psychologischen Beratungsstellen, und der Soziale Dienst des Jugendamtes. Das Ziel dabei ist immer die stabile Reintegration in die Herkunftsschule. Das kann auch eine gemeinsame, fachübergreifende Krisenintervention, um einen Schulausschluss bzw. weiteren Abbruch des Schulbesuchs zu verhindern. Die Überführung in eine bedarfsangemessene weitere Unterstützung, die zur Stabilisierung der individuellen Lebenslage beiträgt, kann ggf. ein anderes Ziel der Begleitung sein. Wenn eine Reintegration in den Regelbetrieb nicht möglich ist, da zunächst ein speziellerer Unterstützungsbedarf vorhanden ist und andere belastende Themen im Vordergrund stehen, ist der Anschluss an diese weiteren Unterstützungssysteme primäres Ziel der Begleitung. In diesem Fall sind insbesondere die Vermittlung an den medizinisch-therapeutischen Bereich und/oder intensivpädagogische Maßnahmen (z. B. stationäre Unterstützung im Rahmen der Jugendhilfe) zu erwägen.
Inhalte und Methoden:
- Sozialpädagogische Einzelbetreuung der Schülerinnen und Schüler und schulische Förderangebote, um entstandene Lücken zu schließen.
- Beratung und Unterstützung der Eltern in der Förderung der/des betroffenen Schülerin/Schülers und in der Kooperation mit den Schulen, sowie bei Bedarf zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten im Netzwerk (s. o.). Dazu hat sich bereits im Jahr 2008 ein Arbeitskreis u. a. aus Vertretern des Jugendamtes, des staatlichen Schulamtes, der freien und städtischen Jugendhilfeträger, der Polizei und des Gesundheitsamtes sowie der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Schulpsychologischen Beratungsstelle gebildet.
- Aufsuchende Arbeit durch TRIAS-Mitarbeiter*innen: Schüler*innen werden auch zuhause und/oder in der Schule besucht, um ein gutes Vertrauensverhältnis aufzubauen, aufrecht zu erhalten und direkt vor Ort agieren zu können.
- Enge Kooperation mit den Lehrkräften und Schulsozialarbeiter*innen der beteiligten Schulen sowie weiteren Netzwerkpartner*innen.
- Es erfolgt in jedem Fall eine kleinschrittige, angemessene Zielvereinbarung zusammen mit den Schüler*innen, in denen kurzfristig zu erreichende Ziele schriftlich festgehalten werden, bspw. durch festgelegte Nachholzeiten des verpassten Unterrichtsstoffes zuhause, Terminvereinbarung mit kooperierenden Institutionen, Erstellung eines Tages/Wochenplans, etc.
- Falls notwendig, findet eine schnelle Krisenintervention vor Ort statt, ggf. auch mit kinderpsychiatrischer Unterstützung oder als Schutzmaßnahme des Jugendamtes.
- Wenn die Unterstützungsmöglichkeiten durch TRIAS nicht ausreichend sind, wird eine Kooperation mit dem Jugendamt angestrebt, um weitere Hilfen anbieten zu können.
- Falls eine Jugendhilfemaßnahme installiert ist oder wird, nimmt TRIAS in Absprache mit dem Sozialen Dienst auch an Hilfeplangesprächen
- Die Beratung anderer Institutionen zum Thema Schulabsentismus im Einzelfall (Beratungsstellen, Sozialer Dienst, Hilfen zur Erziehung, u. a.) ist ebenfalls Bestandteil der Aufgabe von TRIAS.
Was gelingt aus Ihrer Sicht besonders gut?
Katrin Dreher: Der Zugang erfolgt niederschwellig direkt über die Schule, die Schulsozialarbeiter*innen, die Eltern, Netzwerkpartner*innen oder die betroffenen Schülerinnen/Schüler selbst. Alle können uns mit ihren Anliegen direkt kontaktieren.
Für den formalen Zugang zum Projekt muss eine unterschriebene Einverständniserklärung der Teilnehmerin/ des Teilnehmers und eine unterschriebene Datenschutzerklärung vorliegen.
Die Umsetzung des TRIAS-Konzepts durch die freien Träger der Jugendhilfe ermöglicht einen sehr niederschwelligen Zugang und eine zeitnahe Intervention. Die TRIAS-durchführenden Träger arbeiten seit Jahren in einem einzelfallunabhängigen fachlichen Netzwerk – dem Arbeitskreis Schulabsentismus – mit weiteren Kooperationspartner*innen zusammen, um grundsätzlich die Qualität des Angebots zu sichern und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Durch eine enge regionale Kooperation mit den Akteur*innen aus der Jugendarbeit und der Schulsozialarbeit an den Schulen ist es schnell möglich, mit Eltern und Schüler*innen eine gute und passende Unterstützung zu entwickeln. TRIAS ist eine optimale Einzelfallhilfe in enger Kooperation zwischen Schule, Schulsozialarbeit, Eltern, Schüler*innen und bei Bedarf mit der Jugendhilfe. Die Erfolgsquote der Arbeit von TRIAS liegt bei rund 95 Prozent. Nur in sehr wenigen Einzelfällen werden keine hinlänglichen Fortschritte erreicht.
Welche Herausforderungen zeigen sich?
Katrin Dreher: Im Rahmen der Corona-Pandemie haben vermehrt Eltern einen Schulbesuch ihres Kindes unterlaufen bzw. gar verhindert. In diesen Fällen hat die Elternarbeit einen zunehmenden Stellenwert im Betreuungssystem eingenommen, was sich auch in der Diagnostik und Behandlung der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (mit Psychiatrischer Institutsambulanz (PIA), Tagesklinik sowie stationärem Bereich) widerspiegelt. So sind Kinder/Jugendliche wesentlich häufiger Symptomträger*in labiler Familiensysteme und konfliktbelasteter Eltern, die dann die eigentlichen Zielpersonen der Unterstützungssysteme sein müssten. An dieser Stelle wird deutlich, dass die Behandlung von Schulabsentismus nur im kooperativen Zusammenwirken unterschiedlicher Fachdisziplinen gelingen kann und im Wortsinn not-wendig ist. Die Gefahr einer Krankheitszuschreibung und chronifizierten Psychiatrisierung von Kindern/Jugendlichen hat zugenommen, was dazu führen kann, dass eine Rückführung in Regelangebote deutlich erschwert bis unmöglich wird. Daher sind pädagogische, lebensfeldnahe Unterstützungsangebote weitaus hilfreicher und klar erforderlich, um im alltagsnahen Kontext zeitnah und effizient durch Familienbegleitung eine nachhaltige gesellschaftliche Teilhabe in den schulischen Regelangeboten zu ermöglichen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der zuvor genannten Entwicklung ist die bestehende Schulpflicht der Kinder/Jugendlichen, dessen Einhaltung die originäre Aufgabe der Eltern ist. Den durch Verhalten der Eltern verhinderten Schulbesuch hat der Gesetzgeber im § 1666 BGB eindeutig als Kindeswohlgefährdung klassifiziert, der der Staat in seinem Wächteramt entsprechend entgegenwirken muss. Dies zu beurteilen und ggf. notwendige Schritte – auch mit Eingriffen in Elternrechte – einzuleiten und durchzusetzen, ist Aufgabe der Familiengerichte. Hier hat sich die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Akteur*innen im Landkreis in den letzten Jahren sehr weiterentwickelt. Dies zeigt sich beispielsweise in der regelmäßigen Teilnahme des Familiengerichts an den Treffen des „Arbeitskreises Schulabsentismus im Landkreis Böblingen“. Staatliche Hilfeleistungen sind vorrangig vor Eingriffen in das Elternrecht einzusetzen. Hier kommt TRIAS als aufsuchende Jugendhilfeleistung mit Spezialkenntnissen im Bereich der schulischen Landschaft im Landkreis Böblingen und konkret im Umgang mit Schulabsentismus eine besondere Bedeutung zu, um genau diese im Einzelfall notwendigen, passgenauen Hilfen anbieten zu können. In familiengerichtlichen Verfahren ist regelhaft der Soziale Dienst des Jugendamtes als sozialpädagogische Fachbehörde beteiligt, um eben diesen Suchprozess nach geeigneten und notwendigen Hilfen unter Beteiligung der Familie zu unterstützen und entsprechende Hilfen im Einzelfall anzubieten. Durch die regulative Aufgabe des Familiengerichts kommt dieser Instanz eine besondere, quantitativ und qualitativ in der Praxis zunehmend wichtige Aufgabe zu.