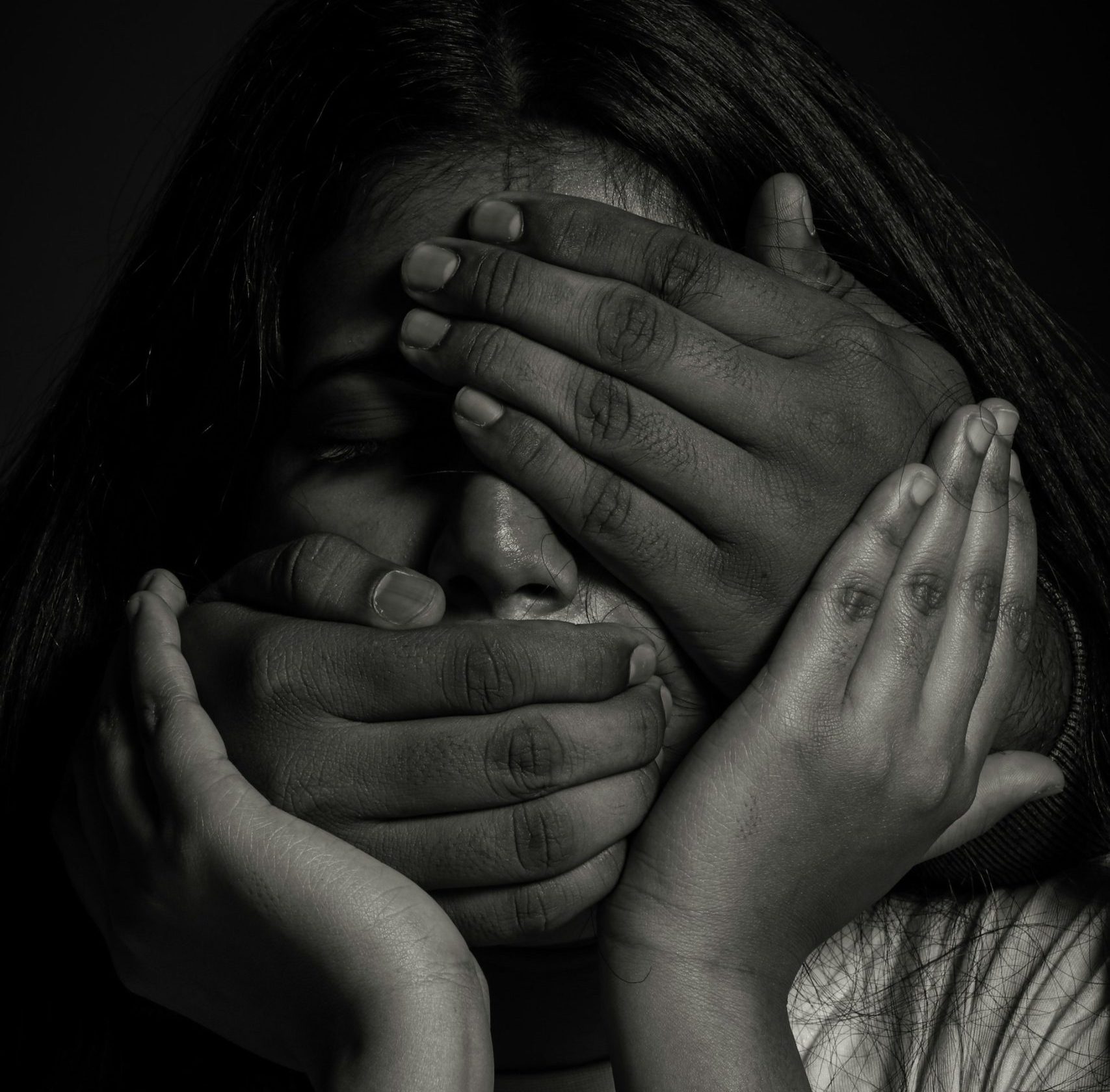Vor mehr als zehn Jahren, wurde die UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) beschlossen. Am 26. März 2009 trat die BRK in Deutschland in Kraft. Laut BRK müssen alle Schüler_innen Zugang zu allgemeinbildenden Schulen erhalten, und die Bundesländer haben sich mit der Ratifizierung der Konvention verpflichtet, ihr Bildungswesen inklusiv zu gestalten. Doch ist Inklusion kein Prozess, der sich verordnen lässt, er muss von den Akteuren vor Ort mitgetragen werden. Die Umsetzung inklusiver Bildung stellt das Bildungssystem vor komplexe Herausforderungen. Zwar gibt die BRK keine Zeitvorgabe für ihre Umsetzung. Doch findet die Friedrich-Ebert-Stiftung es sei an der Zeit, Bilanz zu ziehen und zu prüfen, inwieweit die einzelnen Bundesländer ihre Bildungswesen inklusiv gestalten. Der veröffentlichte Ländervergleich gibt darauf Antworten.
Umfassender Überblick
Der Ländervergleich betrachtet verschiedene Bausteine eines inklusiven Schulsystems: Statistische Daten zu Förder-, Inklusions- und Exklusionsquoten, die Schulgesetzgebung, politische Konzepte auf dem Weg zur inklusiven Bildung, die Finanzierung sowie qualitative Aspekte inklusiver Bildung, etwa die Lehreraus- und -fortbildung. Konzepte und Ausbauschritte werden gegenüber gestellt.
Nicht alle Bundesländer haben ihre Schulgesetze angepasst
Bei der Betrachtung verschiedener Bausteine wird deutlich, dass mit Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein drei Bundesländer die Umgestaltung ihres Bildungssystems zu einem inklusiven besonders konsequent angegangen sind.
Auch die anderen Bundesländer haben Schritte auf dem Weg zu einem inklusiven Bildungssystem eingeleitet. Nicht alle jedoch haben ihre Schulgesetze den Vorgaben der BRK angepasst. In Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen besteht ein Ressourcenvorbehalt für die Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der allgemeinen Schule. In den schulgesetzlichen Regelungen von Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt ist zudem kein Vorrang des inklusiven Unterrichts eingeräumt.
Die weiteren Schritte zur Umgestaltung des Bildungswesens lassen sich grob in drei Modelle einteilen: die Auffassung, dass grundsätzlich alle Schulen den Auftrag erfüllen müssen, inklusiv zu unterrichten.
Als zweites Modell lässt sich die Einrichtung von Profilschulen bezeichnen. Dieses Modell unterscheidet sich von dem dritten Ansatz – Schwerpunktschulen –, weil sich Profilschulen freiwillig zu einer inklusiven Schule entwickeln. Die Schwerpunktschulen hingegen werden vom Land beauftragt.
Der Ländervergleich „Inklusive Bildung in Deutschland“ und die 16 Länderhefte zur Inklusiven Bildung geben einen umfassenden Überblick über die Umsetzung inklusiver Bildung in den Bundesländern. Download unter: www.fes.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=30514&token=bb190e2da3ea59a73aaf32624362a532d5e98982
Quelle: Friedrich-Ebert-Stiftung