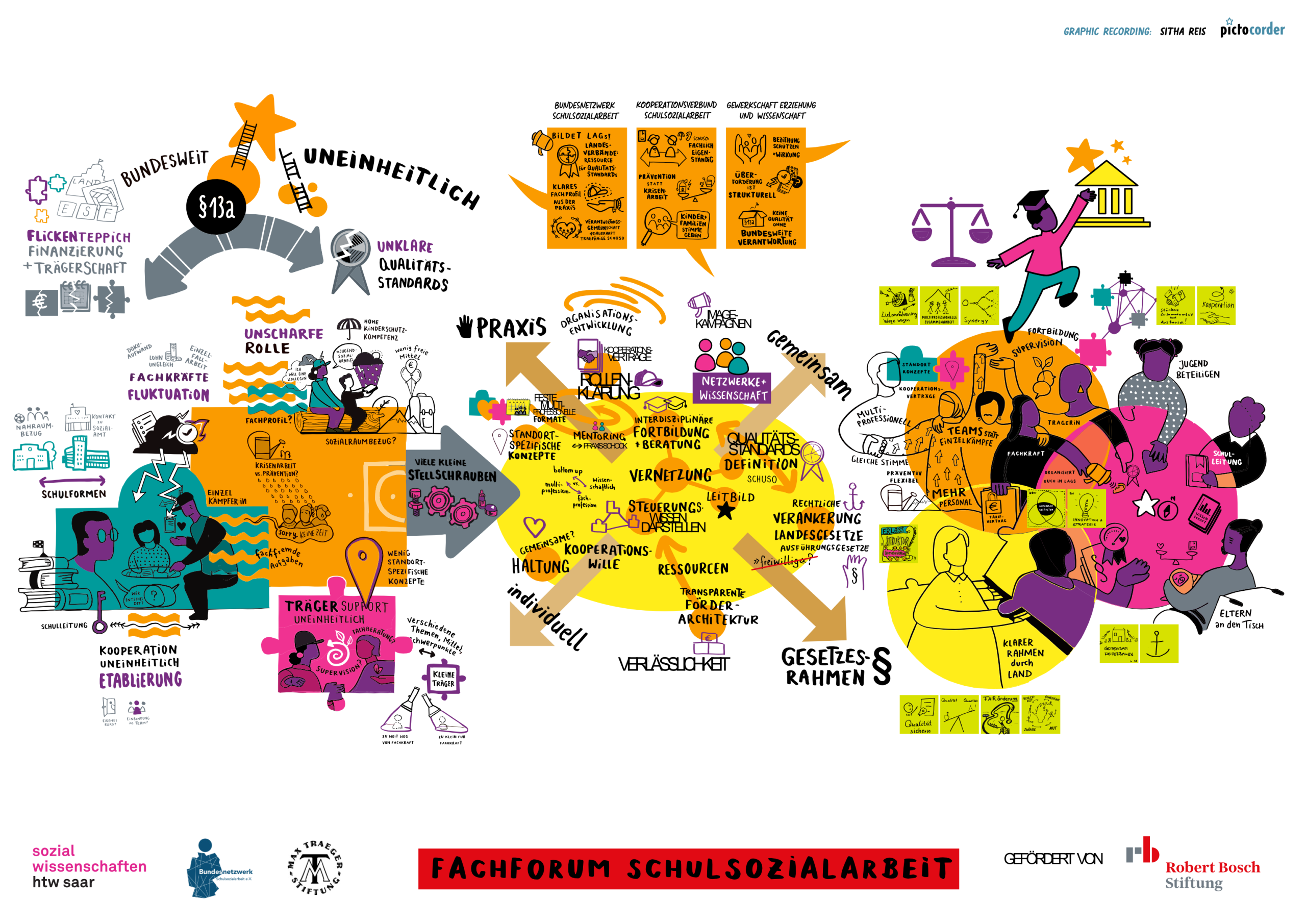Warum es eine sozial gerechte Digitaloffensive braucht – und welche Rolle Fachkräfte der Sozialen Arbeit dabei spielen können, zeigt die Vorstellung der Studie „Digital Skills Gap“. In einer zunehmend digitalisierten Welt ist der Zugang zur digitalen Welt längst keine optionale Angelegenheit mehr, sondern eine Grundvoraussetzung für soziale Teilhabe: Sei es in Schule und Ausbildung, im Erwerbsleben oder im zivilgesellschaftlichen Diskurs sowie bei der Inanspruchnahme öffentlicher Dienstleistungen, deren Beantragung oder Nutzung zunehmend digitalisiert werden. Doch während viele davon ausgehen, dass „die Jugend“ bereits mit digitalen Fähigkeiten ausgestattet ist, zeigen Erhebungen wie die Studie „Digital Skills Gap“ eine tiefgreifende soziale Spaltung. Diese betrifft besonders Jugendliche, die von Armut bedroht oder betroffen sind.
Die Studie „Digital Skills Gap“, durchgeführt von der Initiative D21 und dem mmb Institut, untersucht den Stand und die Verteilung digitaler Kompetenzen innerhalb der deutschen Bevölkerung. Anders als frühere Erhebungen fokussiert sie nicht nur auf klassische demografische Merkmale wie Alter oder Bildung, sondern analysiert digitale Fähigkeiten im Kontext konkreter Lebenslagen. Damit kombiniert sie Einkommen, Bildungsgrad, Beruf, Wohnsituation und soziales Umfeld. Im Ergebnis wird deutlich, dass lediglich 29 % der Menschen mit niedrigem Bildungsniveau über alle fünf grundlegenden digitalen Basiskompetenzen (Informationssuche, Kommunikation, Inhalte gestalten, Sicherheit, Problemlösen) verfügen. Bei einkommensschwachen Menschen liegt die Quote mit etwa 32 % kaum höher. Diese Trennung erfolgt, weil Bildung und Einkommen unterschiedliche Ursachen und Effekte auf digitale Kompetenzen haben:
- Bildungsferne Gruppen fehlen oft die didaktischen Grundlagen und Lernstrategien, um digitale Fähigkeiten systematisch zu erwerben.
- Einkommensarme Gruppen verfügen häufiger über weniger Ausstattung, schlechtere technische Infrastruktur und geringere finanzielle Ressourcen für digitale Lernangebote.
Die Studie betont, dass beide Faktoren ineinandergreifen können, aber eben nicht identisch sind.
Der Monitor „Jugendarmut in Deutschland“, herausgegeben von der Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit (BAG KJS) e. V., befasst sich mit digitaler Armut unter anderem in seinen Ausgaben 2022 und 2024/2025. Es wird dargestellt, wie Armut bei Kindern und Jugendlichen mit digitaler Benachteiligung einhergeht. Vielfach kommt der Jugendarmutsmonitor zu mit der „Digital Skills Gap“-Studie übereinstimmenden Schlussfolgerungen.
Digitale Armut im Monitor Jugendarmut: Die Grundausstattung ist ein Schlüsselfaktor
Bereits im Jahr 2022 konstatierte der Monitor: „Digitale Teilhabe ist schon jetzt eine Frage des Geldbeutels.“ Der Digitalisierungsindex in Haushalten mit unter 1.000 € Nettoeinkommen lag bei 53 %, während in Haushalten mit über 4.000 € Einkommen etwa 72 % erreicht wurden. Nur 47 % der Haushalte unter 2.000 € besaßen einen Laptop.
Aus dem Jugendarmutsmonitor 2024/2025 ergibt sich: Eine*r von fünf Jugendlichen in Armut hat keinen Internetanschluss – bei 31,6 % liegt das an finanziellen Gründen. Ohne Zugang zu Internet und digitalen Geräten kann aber kaum digitale Kompetenz aufgebaut werden. Der fehlende Zugang zur digitalen Welt erzeugt nicht nur Wissenslücken, sondern verstärkt soziale Spaltung. Jugendliche aus Armutsverhältnissen und Haushalten mit geringer Medienkompetenz halten Themen wie Fake News, Datenschutz, oder Desinformationen für weniger relevant. Eltern mit Medienkompetenz fördern aktiv einen reflektierten Umgang. Diese Ressource fehlt oft in armutsbelasteten Haushalten.
Verstärkung digitaler Ungleichheiten
Die Befunde ergänzen sich gut. Die „Digital Skills Gap 2025“-Studie zeigt, dass niedriges Bildungsniveau und geringe Einkommen mit einer deutlich niedrigeren Wahrscheinlichkeit digitaler Basiskompetenz einhergehen. Der Jugendarmutsmonitor liefert konkrete Ursachen: fehlende Grundausstattung, kein Anschluss, fehlende mediale Begleitung. So werden junge Menschen mit Potenzial, aber ohne Zugang zur digitalen Welt von einer umfänglichen gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen.
Die Annahme, Jugendliche oder junge Erwachsene seien automatisch kompetente „Digital Natives“, greift zu kurz – ohne reflektierte Fähigkeiten bleiben sie anfällig für digitale Gefahren. Die Erkenntnis, dass 1 von 5 Jugendlichen in Armut keinen Internetanschluss hat, verdeutlicht, dass das Problem den Alltag durchdringt – mit weitreichenden Konsequenzen.
Bildung als Teil der Lösung, nicht der alleinige Schlüssel
Die Studie hebt hervor, dass formale Bildung allein das Problem nicht lösen kann. Jugendarmut führt zur Reduzierung von Ressourcen. Zeit, Ruhe und Infrastruktur fehlen, die jedoch notwendig wären, um Medienkompetenz aufzubauen. Die digitale Teilhabe beginnt mit der Ausstattung – nicht im Klassenzimmer.
Von der Analyse zur Praxis der Sozialen Arbeit: JMD digital-hub als Beispiel für gelingende Teilhabe
Das Modellprojekt „JMD digital-hub”, das unter anderem von der BAG KJS umgesetzt wird, integriert digitale Räume und Tools systematisch in die Arbeit der Jugendmigrationsdienste (JMD). Diese richten sich an junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren mit Einwanderungsgeschichte und zielen auf ihre soziale, schulische und berufliche Integration ab.
Mit dem digital-hub wird die klassische Beratung niedrigschwellig ins Digitale erweitert – etwa durch Online-Beratung, digitale Gruppenformate oder Blended Counseling. Ziel des Projekts: Digitale Räume sollen nicht nur Hilfsmittel sein, sondern soziale Räume, in denen junge Menschen Zugang, Beteiligung und Unterstützung erleben können. Gerade in prekären Lebenslagen, in denen Geräte, WLAN oder mediale Begleitung fehlen, kann dieser Zugang entscheidend für Teilhabe sein. Das Projekt zeigt exemplarisch, wie digitale Infrastruktur, Fachkräftekompetenz und sozialpädagogische Haltung zusammenwirken können, um Jugendlichen Teilhabechancen auch im digitalen Raum zu eröffnen.
Ergänzendes Praxisbeispiel: Studierende begleiten Einrichtungen der Jugendsozialarbeit bei der Digitalisierung
Ein weiteres innovatives Beispiel liefert die Kooperation der Technischen Hochschule Köln (TH Köln) mit dem Deutschen Kolpingwerk und der IN VIA Akademie, beide Mitglieder der BAG KJS. Im Rahmen des Studiengangs am Institut für Medienforschung und Medienpädagogik (IMM) entwickeln Studierende gemeinsam mit Einrichtungen der Jugendsozialarbeit konkrete Digitalisierungskonzepte. Seit Herbst 2020 haben mehrere Einrichtungen über zwei Semester hinweg mit Studierenden Digitalisierungsansätze erarbeitet und in die Praxis umgesetzt – etwa zur digitalen Kommunikation mit Jugendlichen, zum Aufbau sozialer Medien oder zur Integration digitaler Tools in Beratung und Gruppenarbeit.
Diese Projekte zeigen: Wissenschaft und Praxis können gemeinsam tragfähige Wege in die digitale Transformation der Sozialen Arbeit entwickeln – besonders dann, wenn sie auf pädagogische Qualität, Partizipation und Ressourcenorientierung setzen. Gleichzeitig profitieren Einrichtungen direkt von fachlich fundierter Begleitung und die Studierenden lernen praxisnah, wie Digitalisierung sozial gerecht gestaltet werden kann.
Aktuell startet im Herbst 2025 bereits die sechste Runde der Kooperation. Einrichtungen der Jugendsozialarbeit können sich noch für eine Teilnahme bewerben und so die Chance nutzen, mit Unterstützung der TH Köln innovative Digitalisierungskonzepte zu entwickeln.
Fazit
Die Ergebnisse aus der „Digital Skills Gap“-Studie und dem „Monitor Jugendarmut“ ergeben ein klares Bild: Digitale Teilhabe ist heute eine soziale Frage, nicht aus Mangel an Potenzial, sondern wegen systematischer Barrieren. Um Jugendliche, die in Armut leben oder formal niedriger gebildet sind, gesellschaftlich nicht weiter zu exkludieren, braucht es ein digitales Existenzminimum, wie die Diakonie Deutschland, der Evangelische Verband Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt und das Armutsnetzwerk e. V. bereits Ende 2022 forderten. Digitale Teilhabe muss politisch gewollt, strukturell gefördert und sozialpädagogisch begleitet sein.
Autorin: Silke Starke-Uekermann