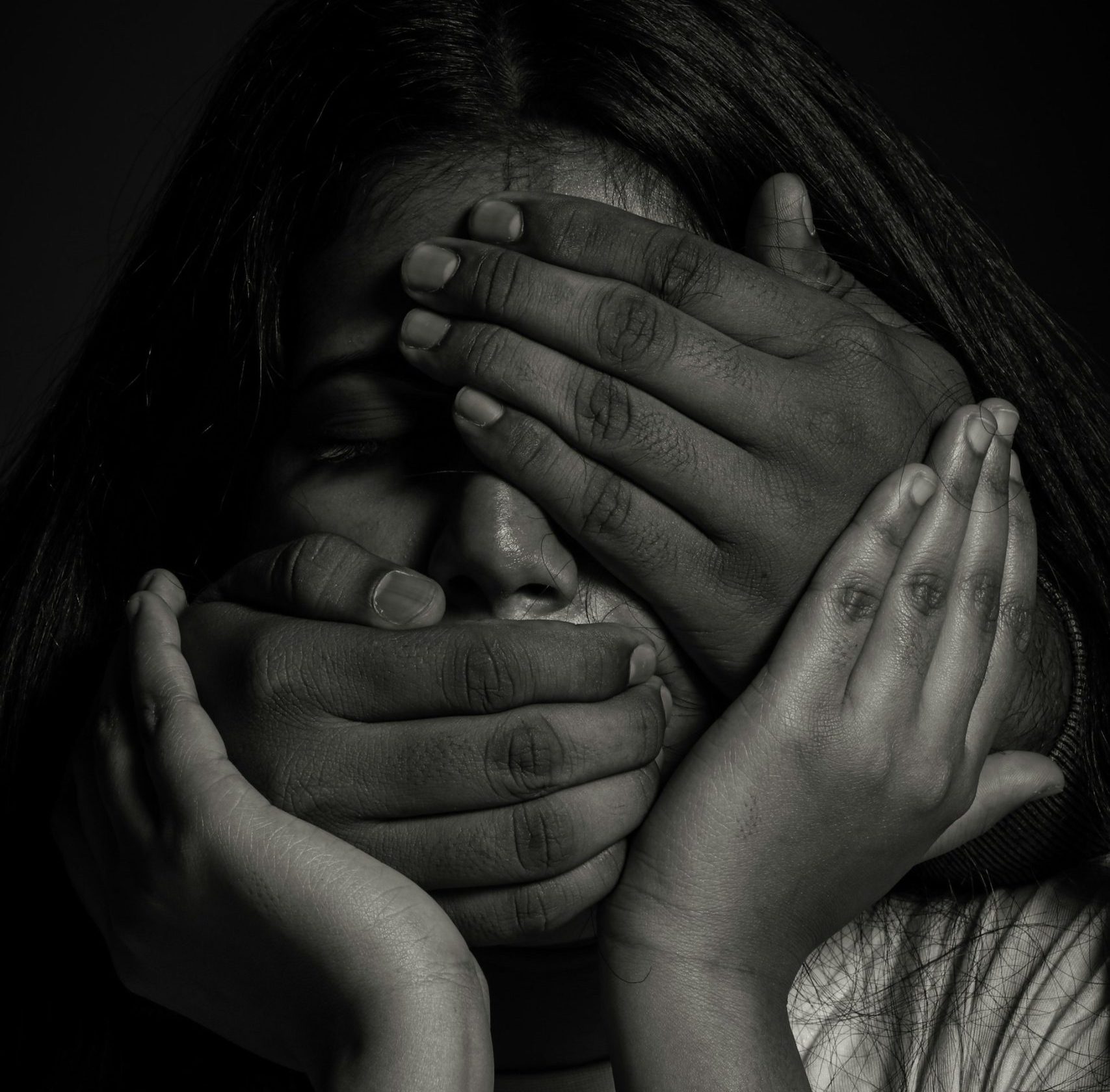Der aktuelle OECD‑Bericht „The State of Global Teenage Career Preparation“ (Mai 2025), basierend auf Daten der PISA-Studie von 2022, wirft ein Schlaglicht auf ein zentrales Problem der Bildungssysteme weltweit: Viele junge Menschen verlassen die Schule ohne eine klare Vorstellung davon, wie es für sie beruflich weitergehen soll. Besonders betroffen sind junge Menschen aus benachteiligten Lebenslagen. Für Deutschland ist das ein deutliches Warnsignal – denn gerade hier verschärft sich das Ungleichgewicht am Übergang Schule-Beruf.
Wachsende Unsicherheit bei Berufswünschen
Laut dem Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) haben heute fast 40 % der 15-jährigen Schüler*innen keine realistische Vorstellung davon, welchen Beruf sie später ergreifen möchten – mehr als doppelt so viele wie noch vor zehn Jahren. In Deutschland ist die Zahl mit knapp 50 % sogar besonders hoch.
Diese Unsicherheit bei der Berufswahl ist ein besonderes Risiko für junge Menschen mit individueller Benachteiligung oder Beeinträchtigung. Ihnen fehlen verlässliche Orientierungshilfen, berufliche Vorbilder und gezielte Förderung. Die Folgen sind gravierend: lange Übergangsphasen, Fehlentscheidungen, Ausbildungsabbrüche oder im schlimmsten Fall der vollständige Ausschluss vom Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.
Wunsch und Wirklichkeit klaffen auseinander
Zugleich zeigt der Bericht, dass viele junge Menschen ambitionierte Berufswünsche äußern – etwa Ärzt*in, Ingenieur*in oder Designer*in –, jedoch nicht planen, die dafür notwendigen Bildungswege einzuschlagen. In Deutschland ist diese Diskrepanz besonders ausgeprägt. Vor allem junge Menschen aus sozioökonomisch benachteiligten Familien und Schüler*innen mit schwächeren Leistungen unterschätzen die Bildungsanforderungen für ihre Wunschberufe (jeweils rund 60 %).
Soziale Herkunft entscheidend für Bildungserfolg
Besonders eindrücklich sind die Daten zur sozialen Durchlässigkeit im Bildungssystem: Der OECD-Bericht zeigt, dass der Zugang zu höheren Bildungsabschlüssen stärker vom sozialen Hintergrund als von der tatsächlichen schulischen Leistung abhängt. Entscheidend sind dabei der Bildungsstand der Eltern, deren Beruf sowie das Haushaltsvermögen – zusammengefasst im „ökonomischen, sozialen und kulturellen Status“ der Schüler*innen.
Im OECD-Durchschnitt liegt der Unterschied bei acht Prozentpunkten: Schüler*innen mit schlechteren Schulleistungen und hohem sozialem Status erreichen häufiger einen tertiären Bildungsabschluss als leistungsstärkere Schüler*innen mit niedrigerem Status. In Deutschland ist diese Lücke besonders gravierend – sie beträgt 22 Prozentpunkte.
Das bedeutet: Individuell benachteiligte junge Menschen haben deutlich schlechtere Chancen, obwohl sie schulisch teilweise bessere Leistungen erbringen. Ihre soziale Herkunft wirkt sich stark auf ihren weiteren Bildungsweg aus – ein klarer Hinweis auf strukturelle Ungleichheiten im deutschen Bildungssystem.
Aktivitäten der Berufsorientierung
Die OECD-Studie zeigt deutlich: Junge Menschen, die an Aktivitäten zur Berufsorientierung teilnehmen, haben mit höherer Wahrscheinlichkeit klare Berufswünsche, können ihre späteren Chancen realistischer einschätzen und streben häufiger einen tertiären Bildungsabschluss an.
Zu solchen Aktivitäten zählen laut Bericht unter anderem das Ausfüllen berufsbezogener Fragebögen, Internetrecherchen, Praktika, Gespräche mit Berufsberater*innen, der Besuch von Jobmessen, Bewerbungstrainings sowie Hospitationen oder Betriebserkundungen.
Allerdings bestehen auch hier deutliche Unterschiede je nach sozialer Herkunft: Schüler*innen mit einem niedrigeren ökonomischen, sozialen und kulturellen Status nehmen seltener an diesen berufsorientierenden Aktivitäten teil als ihre Mitschüler*innen aus privilegierteren Verhältnissen. Damit bleibt für viele benachteiligte junge Menschen die Chance auf berufliche Orientierung und Teilhabe aus.
Ausreichende Vorbereitung auf die Zukunft?
Ein weiteres zentrales Ergebnis des Berichts: Viele junge Menschen fühlen sich mit Blick auf ihre berufliche Zukunft zu wenig vorbereitet. Sie geben an, dass sie von ihrer Schule nur unzureichende Unterstützung bei der Berufsorientierung erhalten haben.
Insbesondere Schüler*innen mit niedrigem ökonomischem, sozialem und kulturellem Status äußern häufiger Sorgen, dass finanzielle Hürden sie daran hindern könnten, ihre Interessen zu verfolgen. Zudem empfinden sie den Schulbesuch häufiger als Zeitverschwendung – eine Einschätzung, die ihre Motivation und Zuversicht zusätzlich belastet.
Auch insgesamt schneiden deutsche Schüler*innen im internationalen Vergleich schlecht ab, was ihre persönliche Berufsvorbereitung betrifft:
- Nur gut die Hälfte der Schüler*innen in Deutschland fühlt sich gut über mögliche Bildungs- und Berufswege nach dem Schulabschluss informiert. Im OECD-Durchschnitt sind es knapp 70 %.
- Über 70 % der deutschen Schüler*innen geben an, von ihrer Schule schlecht auf das Erwachsenenleben vorbereitet worden zu sein – auch hier liegt der OECD-Durchschnitt deutlich niedriger, bei rund 50 %.
- Nur 35 % der deutschen Schüler*innen stimmen der Aussage zu, dass die Schule ihnen geholfen habe, selbstbewusste Entscheidungen zu treffen. Im OECD-Vergleich sind es über 50 %.
- Auch beim Praxisbezug fällt Deutschland zurück: Nur gut 40 % der Schüler*innen sagen, dass sie in der Schule Dinge gelernt hätten, die ihnen in einem zukünftigen Job nützlich sein könnten – im OECD-Durchschnitt liegt dieser Wert bei knapp 70 %.
- Schließlich fühlen sich lediglich 40 % der Schüler*innen in Deutschland gut auf ihren „zukünftigen Weg“ vorbereitet – auch hier deutlich unter dem OECD-Durchschnitt von rund 70 %.
Diese Zahlen belegen eindrücklich: Die schulische Berufsorientierung in Deutschland erreicht viele junge Menschen nicht – und am wenigsten jene, die sie am dringendsten bräuchten.
Was jetzt zu tun ist
Vor dem Hintergrund der genannten Ergebnisse des OECD-Berichts können folgende Handlungsfelder abgeleitet werden:
- Frühe, kontinuierliche Berufsorientierung an Schulen: Diese muss verbindlich und systematisch verankert werden – nicht als punktuelle Veranstaltung, sondern als durchgängiger Prozess.
- Mehr Praxiskontakte ermöglichen: Schulen müssen enger mit Betrieben, Handwerkskammern, Ausbildungszentren und Jugendberufsagenturen kooperieren. Vor allem durch reale Begegnungen mit der Arbeitswelt können junge Menschen tragfähige Berufsvorstellungen entwickeln.
- Benachteiligte junge Menschen gezielt fördern: Förderprogramme müssen dort ansetzen, wo junge Menschen zusätzliche Begleitung benötigen – sei es sprachlich, emotional oder sozial. Mentoring, individuelle Beratung und sozialpädagogische Begleitung spielen dabei eine Schlüsselrolle.
Jugendsozialarbeit als Teil der Lösung
Für die Jugendsozialarbeit, insbesondere die Jugendberufshilfe, ist der Bericht ein deutlicher Handlungsauftrag. Sie arbeitet seit Jahren mit genau den jungen Menschen, die laut OECD besonders gefährdet sind: mit jungen Menschen in prekären Lebenslagen, mit Schulverweigerer*innen, mit jungen Menschen ohne Abschluss oder mit Vermittlungshemmnissen.
Die Fachkräfte der Jugendsozialarbeit leisten hier wertvolle Arbeit: Sie begleiten individuell, stärken Motivation und Selbstwirksamkeit, vermitteln zwischen Schule, Betrieb und Sozialleistungsträgern – und sind oft die einzigen Ansprechpartner*innen am Übergang von der Schule in den Beruf.
Doch eben jene Arbeit ist vielerorts unterfinanziert und kämpft selbst mit unsicheren Rahmenbedingungen. Der OECD-Bericht macht deutlich: Es braucht ein flächendeckendes, verlässliches System der beruflichen Orientierung, das soziale Ungleichheiten ausgleicht. Die Jugendsozialarbeit muss in dieses System fest eingebunden und angemessen gefördert werden. Daher braucht es jetzt entschlossenes politisches Handeln – und eine starke Jugendsozialarbeit, die jungen Menschen Orientierung, Unterstützung und echte Chancen auf Teilhabe am Arbeitsleben bietet.
Autorin: Sarah Mans (Fachreferentin Jugendberufshilfe der LAG KJS NRW im Netzwerk der BAG KJS)