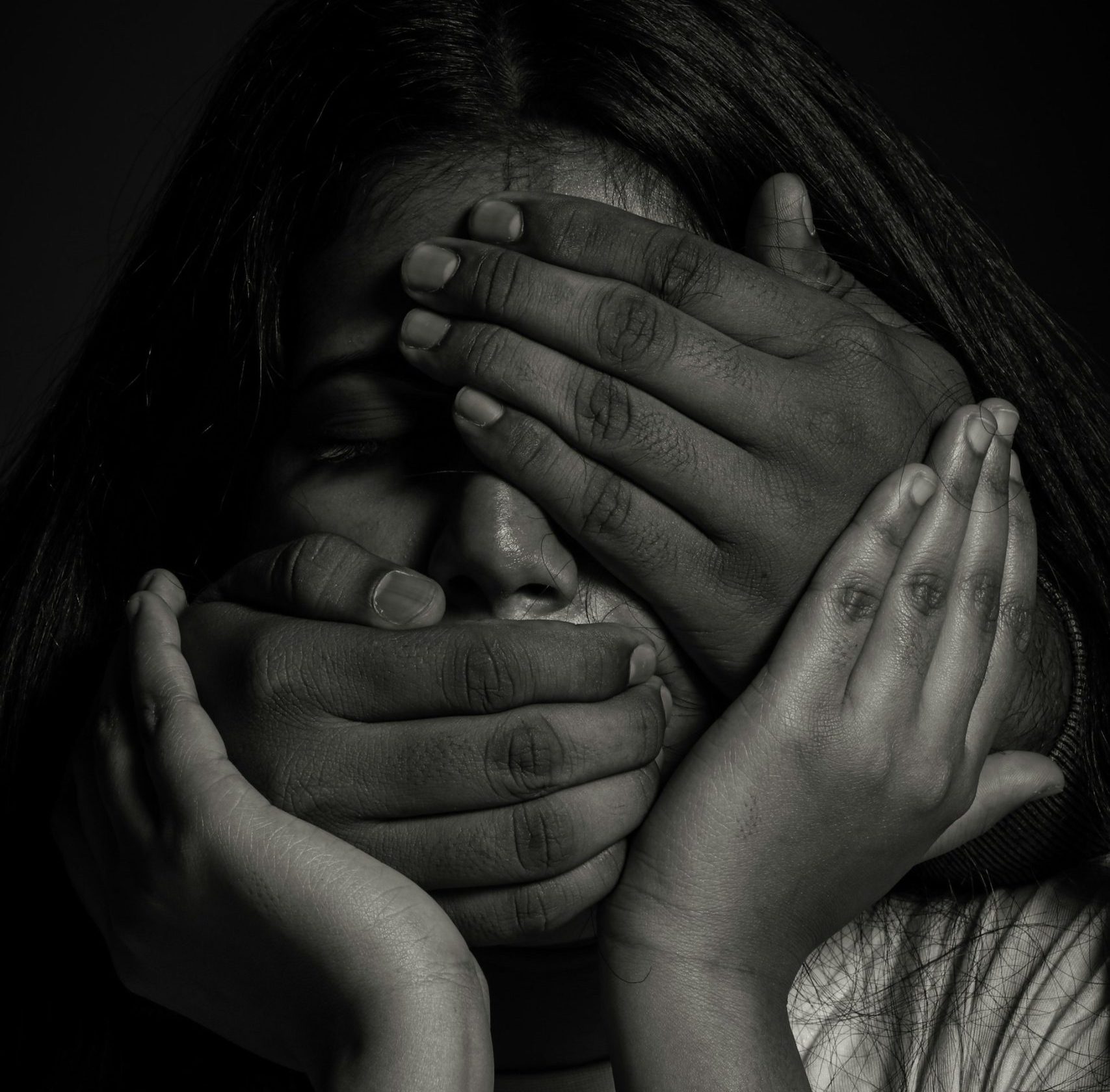Einkommensarme Menschen sind in den vergangenen Jahren ärmer geworden. Das ist eine Bilanz des Armutsberichts des Paritätischen Gesamtverbandes. Das mittlere Einkommen von Personen unterhalb der Armutsgrenze sank im Jahr 2024 gegenüber 2020 preisbereinigt um 60 Euro auf 921 Euro im Monat. „Die Armen werden ärmer“, warnt Joachim Rock, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen.
Dem neuen Armutsbericht des Paritätischen zufolge müssen in Deutschland 15,5 Prozent der Bevölkerung zu den Armen gezählt werden. In elf Bundesländern liegt die Quote der Armen über diesem Durchschnitt. Lediglich im Saarland (15,3 %), in Brandenburg (14,9 %), in Schleswig-Holstein (14,7 %), in Baden-Württemberg (13,2 %) und Bayern (11,8 Prozent) bleibt sie unter dem Durchschnitt. Die höchsten Armutsquoten haben Bremen (25,9 %) und Sachsen-Anhalt (22,3 %). Hinter diesen Quoten sind konkret mehr als 13 Millionen Menschen von Armut betroffen, darunter eine hohe Zahl junger Menschen unter 25 Jahren. Die Lage junger Menschen dokumentiert der Monitor Jugendarmut der BAG Katholische Jugendsozialarbeit: Jeder Vierte zwischen 18 und 24 Jahren war 2023 in Deutschland von Armut bedroht. Das entspricht einer Armutsgefährdungsquote von 25 %. Bei den unter 18-Jährigen liegt die Quote bei 20,7 %, sodass mehr als jeder Fünfte armutsgefährdet ist.
Knapp 20 Prozent der Erwerbstätigen sind armutsbetroffen
Der Paritätische analysiert im Armutsbericht unter anderem, welchen Erwerbsstatus betroffene Gruppen haben. Neben Arbeitslosen (10,8 %) sind auch Erwerbstätige (19,9 %) und Menschen im Ruhestand (25,5 %) betroffen. Mit 44 % macht die Gruppe jener, die aus vielfältigen Gründen nicht erwerbstätig sein können, den größten Anteil aus. In dieser Gruppe befinden sich Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr. Die Zahlen zeigen, dass jede*r fünfte Erwerbstätige vom Einkommen nicht den Lebensunterhalt finanzieren kann. Zugleich ist diese Quote leicht gesunken, der Paritätische bilanziert: Positiv entwickelt hat sich die Zahl der Erwerbstätigen in Armut. Ausschlaggebend für diese Verbesserung ist die Erhöhung des Mindestlohnes sowie die Reform des Wohngeldes.
Schutzwirkung des Sozialstaates schrumpft
Aus Sicht des Paritätischen zeigt an diesem Beispiel der Sozialstaat Wirkung. „Der Sozialstaat ist grundsätzlich in der Lage, Einkommensarmut zu reduzieren oder auch ganz abzuschaffen“, heißt es im Bericht und weiter: „Über 40 Prozent der Menschen in Deutschland haben ohne Sozialleistungen (inklusive Rente) ein Einkommen unterhalb der Armutsschwelle und wären daher als arm anzusehen. Nach den Sozialtransfers sinkt diese Quote auf 15,5 Prozent. Dies ist eine erhebliche Leistung: Mehr als 60 Prozent der Menschen, deren Markteinkommen unterhalb der Armutsschwelle liegt, sind 2024 aufgrund sozialstaatlicher Transfers nicht mehr einkommensarm“.
Wenn jedoch Erwerbseinkommen und Beschäftigung steigen und gleichzeitig die Armut in der Summe seit Jahrzehnten nicht abnimmt, scheint ein Problem des sozialstaatlichen Ausgleichs zu bestehen. Der Sozialstaat scheint mit seinem Steuer-, Abgaben- und Transfersystem zunehmend weniger effektiv bei der Bekämpfung von Armut zu werden. Das bedeutet laut Parität: „Die Schutzwirkung des Sozialstaates vor Armut schrumpft“.
Forderungen zur Armutsbekämpfung
Debatten über den weiteren Abbau von Sozialleistungen verschärfen das Problem. Und: Eine Agenda der Armutsbekämpfung auf nationaler Ebene ist nicht erkennbar. Das konstatiert der Paritätische und stellt entsprechende Forderungen auf. Ein Teil dieser Forderungen deckt sich mit dem, was die BAG KJS im Interesse junger Menschen erwartet:
- Familienpolitische Leistungen müssen ausgebaut werden, vorrangig kinder- und jugendbezogene Leistungen müssen vor Armut schützen.
- Das Wohngeld ist ein wichtiges Instrument, um hohe Wohnkosten zu kompensieren. Zugleich muss günstiger Wohnraum bereitgestellt werden.
- Die Grundsicherung in den verschiedenen Facetten muss armutsfest sein.
- Die Arbeitsförderung muss ausgebaut werden, damit Arbeitssuche und -aufnahme besser unterstützt und qualifiziert werden können. Insbesondere sind Maßnahmen des Coachings für junge Menschen wichtig.
- Reformbedarf gibt es beim BAföG. Der Anspruch auf ein menschenwürdiges Existenzminimum muss für Auszubildende und Studierende realisiert werden.
Hinzu kommen Forderungen im Bereich Wohnen, die von der BAG KJS im Rahmen des Monitors Jugendarmut aufgestellt wurden.
Text: Michael Scholl