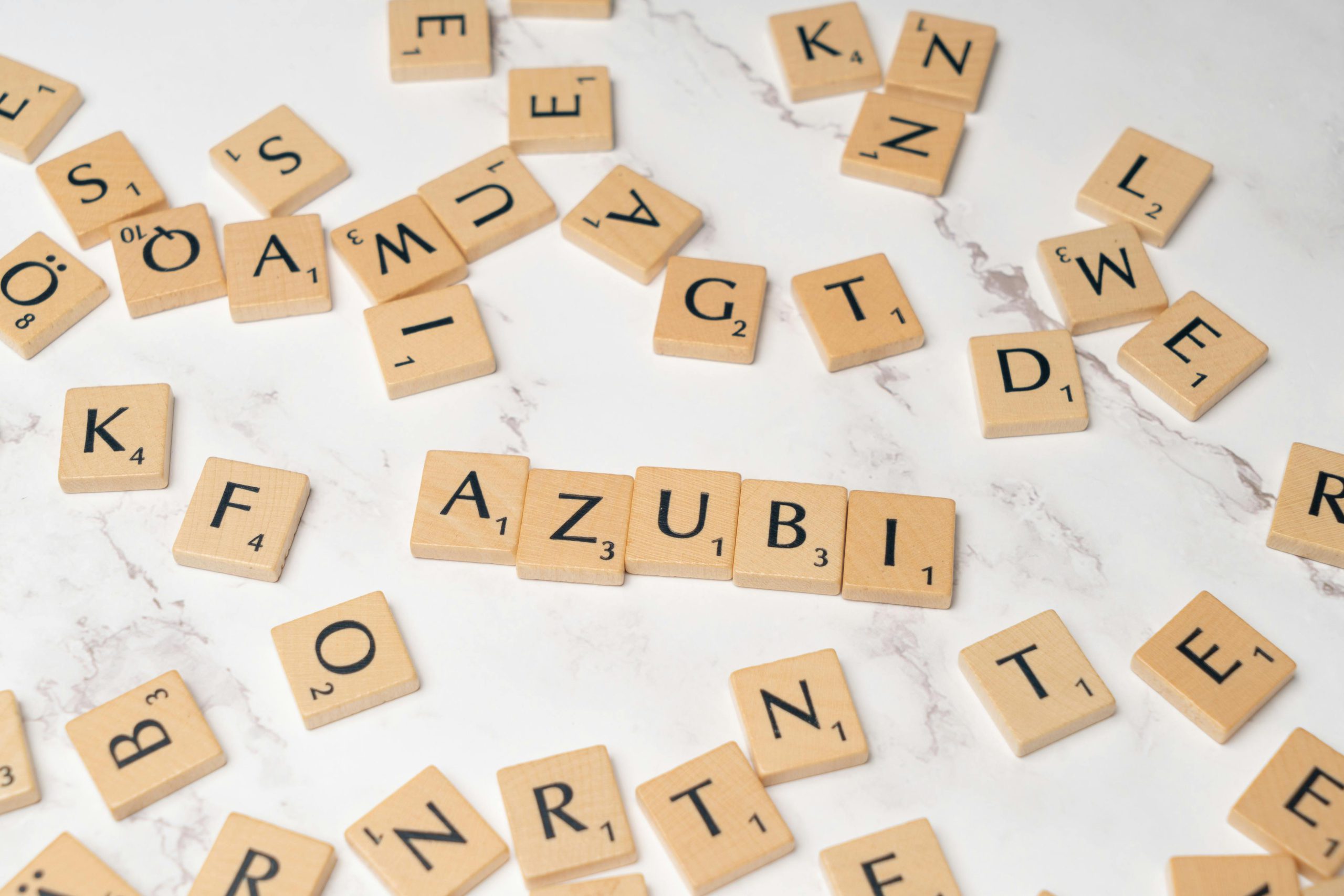Zum Abschluss der Kampagne der Bundesschülerkonferenz (BSK) zur mentalen Gesundheit präsentierte der Generalsekretär Quentin Gärtner einen Zehn-Punkte-Plan zur Verbesserung der Situation an Schulen. Das Anliegen ist klar: Mentale Gesundheit soll in Schulen nicht als individuelles Problem, sondern als strukturelle Aufgabe betrachtet werden.
Im Mittelpunkt der von der BSK formulierten Forderungen stehen:
- Kontinuierlich erreichbare psychosoziale Unterstützungsangebote, nicht nur im Krisenmoment.
- Mehr Schulpsycholog*innen und sozialpädagogische Fachkräfte, eingebunden in multiprofessionelle Teams.
- Schulstrukturen, die Selbstregulation und Medienkompetenz fördern, statt ausschließlich Leistungsdruck aufzubauen.
- Ein Schulklima, das Zugehörigkeit, Sicherheit und Verlässlichkeit gewährleistet.
Die Position der jungen Menschen ist eindeutig: Sie wollen an Lösungen mitarbeiten. Sie möchten Schule als einen Ort gestalten, an dem Lernen und Wohlbefinden nicht im Widerspruch stehen. Gleichzeitig weisen sie darauf hin, dass die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, von stabilen Rahmenbedingungen abhängt.
Studien wie COPSY, das Deutsche Schulbarometer und der DAK-Präventionsradar zeigen seit Jahren: Ein Fünftel bis ein Sechstel der Schüler*innen fühlt sich emotional überlastet. Ein Drittel erlebt Einsamkeit. Die Pandemie hat Wunden hinterlassen, globale Krisen erzeugen Dauerstress und Schulen kämpfen mit Überforderung im System. Diese Entwicklung beeinträchtigt nicht nur individuelles Wohlbefinden, sondern auch gesellschaftliche Zukunftsfähigkeit. Die volkswirtschaftlichen Folgekosten psychischer Erkrankungen beliefen sich im Jahr 2020 auf 56,4 Milliarden Euro. Darauf weist das Institut der deutschen Wirtschaft hin. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und demografischer Entwicklungen wird deutlich, dass Investitionen in die psychische Gesundheit junger Menschen zugleich Investitionen in die gesellschaftliche Handlungsfähigkeit darstellen. Eine Gesellschaft, die sich wünscht, dass junge Menschen gestaltungsstark und zuversichtlich sind, muss sich fragen: Wie soll das gelingen, wenn sie täglich an ihren Grenzen leben? Daher ist es von besonderer Bedeutung, frühzeitig in Präventionsprogramme zu investieren. Studien zeigen, dass rund 50 % aller psychischen Belastungen bereits vor dem 14. Lebensjahr beginnen (s. Kessler et al., 2005, 2007). Die Forderungen junger Menschen sind berechtigt und zugleich eine klare Bestätigung für das, was das Programm Mental Health Coaches (MHC) bereits leistet. Die Themen, die im Rahmen der Kampagne behandelt werden, sind den MHC-Fachkräften aus ihrem Arbeitsalltag bestens vertraut.
Modellvorhaben Mental Health Coaches liefert Lösungsansätze
Das Modellvorhaben Mental Health Coaches (MHC) zeigt, wie Prävention im schulischen Alltag erfolgreich umgesetzt werden kann – bevor psychische Belastungen zu Erkrankungen werden. Das Programm bietet einen niedrigschwelligen Zugang für junge Menschen. Es fördert Selbstregulation, schult Achtsamkeit und vermittelt Handlungsstrategien im Umgang mit Krisenbelastungen. Zudem werden bestehende Hilfestrukturen sichtbar gemacht, während psychische Belastungen entstigmatisiert werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau multiprofessioneller Strukturen an den Schulen. Besonders positiv bewertet werden die zusätzlichen Personalstellen sowie die hohe Flexibilität der Mental Health Coaches.
Bedarfe werden sowohl im Team als auch im direkten Austausch mit den Schüler*innen ermittelt. Die Evaluation bestätigt die hohe Wirksamkeit: Die Maßnahmen greifen, weil sie an den Lebenswelten der Jugendlichen ansetzen. Rückmeldungen von Schüler*innen, Lehrkräften und Schulleitungen zeigen breite Akzeptanz. Gleichzeitig verdeutlichen die Ergebnisse den großen Bedarf an kontinuierlich verfügbaren, dauerhaft verankerten Unterstützungsangeboten – Prävention und psychosoziale Begleitung müssen verlässlich sein, nicht abhängig von befristeten Projekten.
Autorin: Özlem Tokyay