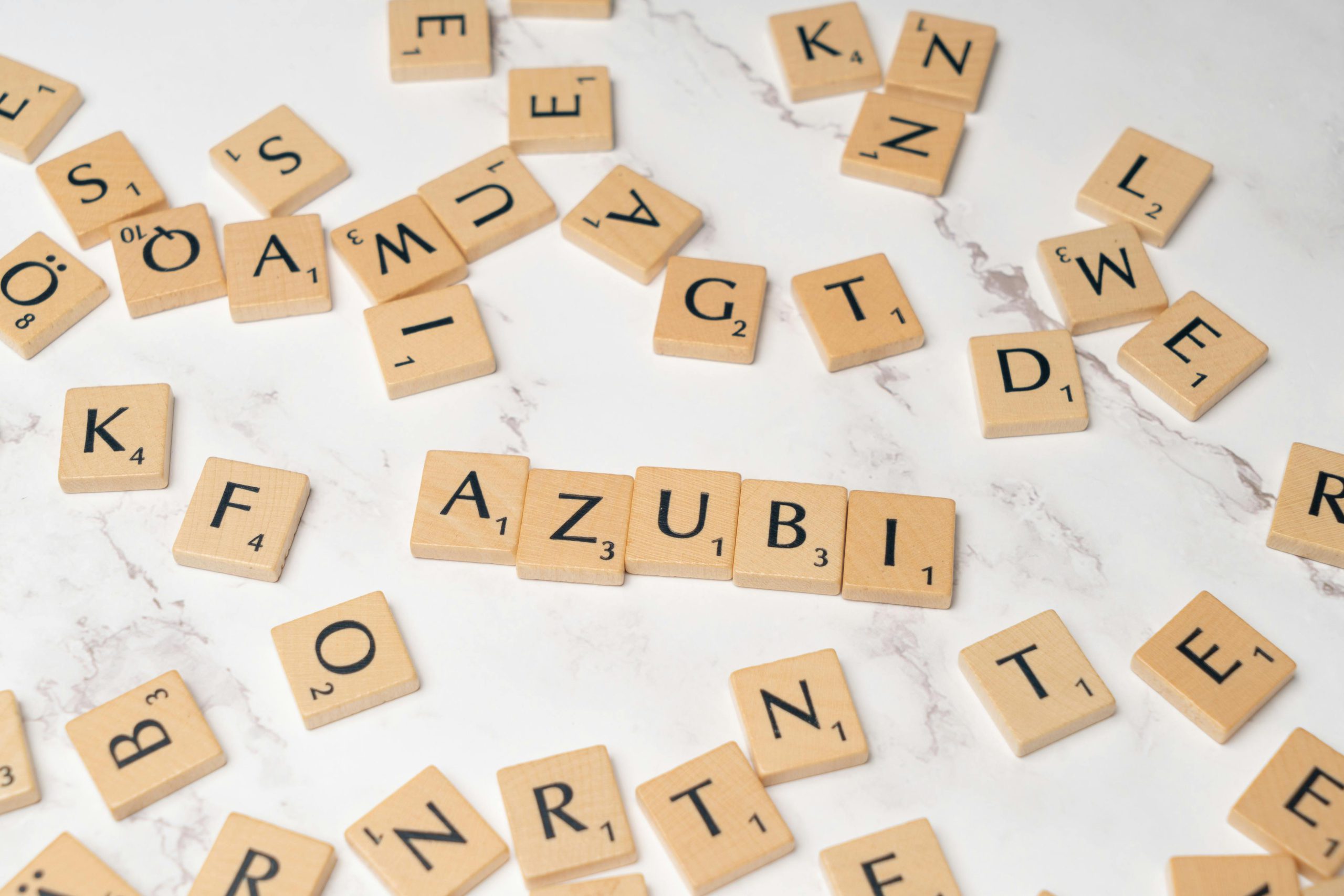Es ist bekannt, dass insbesondere in deutschen Ballungsgebieten Wohnraum zunehmend knapper wird, bezahlbare Wohnungen vielerorts rar sind und der Konkurrenzkampf auf dem stark angespannten Wohnungsmarkt viele Suchende belastet. Verstärkt wird das Problem durch einen erheblichen Sanierungsstau im Gebäudesektor, sowohl im Bereich der öffentlichen Infrastruktur als auch bei privaten Mietwohnungen. Einige davon erreichen zudem zunehmend das Ende ihres Nutzungszeitraums. Wir blicken auf das Wohnen als soziale und ökologische Frage.
Sanierungsstau, Abriss und Neubauten: Auswirkungen für Mensch und Umwelt
Der Umbau des Gebäudesektors wurde von der EU zum zentralen Baustein ihrer Nachhaltigkeitsstrategie definiert, die im Rahmen des Green Deals umgesetzt werden soll. Diese sieht vor, bis zum Jahr 2030 europaweit 35 Millionen Gebäude energetisch zu sanieren. Was auf den ersten Blick eine erfreuliche Nachricht zu sein scheint, offenbart beim zweiten Blick große Herausforderungen. Recherchen des gemeinwohlorientierten Medienhauses CORRECTIV zufolge werden jedes Jahr hunderttausende Häuser in Europa nicht saniert, sondern abgerissen und anschließend durch Neubauten ersetzt. Das hat nicht nur schwerwiegende Konsequenzen für Klima und Umwelt durch ausgestoßene Treibhausgasemissionen bei den Baumaßnahmen, sondern auch für die betroffenen Mieter*innen. Der Abriss bestehender Wohnungen stellt vor allem Menschen mit niedrigeren Einkommen vor große Herausforderungen, die lange Zeit in einfachen und günstigen Wohnungen gelebt haben. Sie verlieren nicht nur ihr aktuelles Zuhause, sondern müssen oftmals auch ihr vertrautes Umfeld verlassen. Denn die Neubauten sind für sie meistens kaum bezahlbar.
Hinter dem Abriss und Neubau dieser Art von Wohnungen stehen laut CORRECTIV häufig kommunale, landeseigene oder städtische Wohnungsunternehmen. Den Satzungen zufolge verfolgen diese den gemeinnützigen Zweck, sicheren und sozial verantwortbaren Wohnraum für eine breite Bevölkerungsschicht zur Verfügung zu stellen – und sollten somit insbesondere für Geringverdienende Perspektiven auf dem Wohnungsmarkt schaffen. Der Haken dabei: Viele dieser neu gebauten Wohnungen werden gefördert vermietet. Man benötigt als Mieter*in somit eine offizielle Berechtigung, wie beispielsweise einen Wohnungsberechtigungsschein (WBS). Letzterer ist jedoch maßgeblich vom Einkommen abhängig, da eine festgelegte Einkommensgrenze dabei nicht überschritten werden darf. Das bringt viele Betroffene in ein Dilemma: Sie sind nicht WBS berechtigt und erhalten auch sonst keine Sozialleistungen. Gleichzeitig verdienen sie zu wenig, um eine realistische Chance auf eine für sie bezahlbare Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt zu haben. Denn insbesondere in Ballungsgebieten sind Mieten sehr hoch und das Angebot an freien Wohnungen ist knapp. Davon sind zwar alle Wohnungssuchenden betroffen, je kleiner jedoch der eigene Geldbeutel, desto schwerer gestaltet sich die Suche. Die inflationsbedingten Preissteigerungen, beispielsweise bei Lebensmitteln und Energie, belasten viele Haushalte zusätzlich und schränken potenzielle Spielräume beim Mietpreis bzw. der Wohnungssuche ein.
Der von der Bundesregierung angekündigte Bau-Turbo soll dem entgegenwirken und zu einer Entspannung auf dem Wohnungsmarkt beitragen. Es werden jedoch Bedenken geäußert, ob der Bau-Turbo tatsächlich zu einer sozial verträglicheren Situation auf dem Wohnungsmarkt und mehr bezahlbaren Wohnraum führen wird: Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes (DMB), befürchtet: Am Ende profitieren Besserverdienende, die sich Wohnraum ohnehin jetzt schon leisten könnten. Als grundlegendes Problem kommt hinzu: Wohnen ist eine zentrale Frage, der niemand ausweichen kann. Viele Menschen sind stark durch die hohen Mieten belastet, etliche geraten dadurch an ihre (finanziellen) Grenzen: Sie nehmen in Kauf, höhere Miete zu zahlen, als sie sich eigentlich leisten können, um zu verhindern, dass sie und ihre Familie das vertraute Umfeld verlassen müssen oder um weiterhin ihre Arbeitsstelle halten zu können.
Soziale Teilhabe für junge Menschen betrifft auch den Bereich Wohnen
Die diversen Herausforderungen im Bereich Wohnen stellen besonders junge Menschen vor große Herausforderungen – vor allem jene, die mit knapperen finanziellen Ressourcen haushalten müssen. Zu hohe Mieten können ihre persönliche Entwicklung im Bereich Verselbstständigung sowie Entscheidungen über ihren beruflichen Weg merklich beeinträchtigen. Wenn eine eigene Wohnung oder ein WG-Zimmer nicht bezahlbar ist, müssen sie weiterhin bei ihrer Familie wohnen. Dies kann sich wiederum auf den weiteren beruflichen Werdegang und die Wahl der Ausbildung bzw. Studium auswirken. Da vor allem viele Familien mit geringeren Haushaltsnettoeinkommen durch hohe Mieten überdurchschnittlich stark belastet sind, bleibt ihnen weniger Geld für andere Dinge übrig. Bestehende Ungleichheiten werden dadurch verstärkt. Aktuelle Zahlen einer im März 2025 veröffentlichten Studie des Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) belegen die zunehmend ungleiche Mietkostenbelastung, die vor allem bei Menschen mit niedrigen Einkommen stark angestiegen ist. Bei Personen mit Zuwanderungsgeschichte ist diese Ungleichheit noch stärker ausgeprägt.
Um jungen Menschen eine angemessene Perspektive auf soziale Teilhabe im Bereich Wohnen zu ermöglichen, muss adäquater, bezahlbarer Wohnraum sichergestellt werden. In ihren Forderungen für eine #StarkeZukunft für junge Menschen fordert die Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit (BAG KJS), wirksame Instrumente gegen unverhältnismäßige oder grundlose Mietsteigerungen einzuführen. Der soziale Wohnungsbau, insbesondere zugunsten junger Menschen und Familien, sollte deutlich verstärkt werden. Die Handlungsfähigkeit von Trägern und Sozialverbänden, die Akteure auf dem Wohnungsmarkt sind, muss durch eine Reform des Gemeinnützigkeitsrechts dauerhaft garantiert und gefördert werden.
Wege zu adäquatem, bezahlbarem Wohnraum
Doch neben einer Förderung des sozialen Wohnungsbaus wird auch davon unabhängiger, bezahlbarer Wohnraum benötigt, der keine WBS-Bescheinigung erfordert und dennoch sozial gerecht ist. Dadurch wird auch Menschen mit geringeren Haushaltseinkommen ermöglicht, adäquate, bezahlbare Mietwohnungen zu finden. Ein Weg dorthin wäre, die Mietpreisbremse dauerhaft zu etablieren.
Ein weiterer wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist der Klimaschutz. Eine Studie des Wuppertal Instituts aus dem Jahr 2022 belegt, dass energetische Sanierung ökologisch sinnvoller und zudem günstiger sein kann als der Abriss alter Wohnhäuser und Neubauten. Grund dafür sind die großen Mengen an freigesetzten Treibhausgasen beim Bauen. Diese verschärfen die Klimakrise zusätzlich und stellen ein Problem für die Erreichung und Einhaltung vereinbarter Klimaziele und der Reduktion von CO2-Emmissionen dar. Die Deutsche Umwelthilfe spricht sich dafür aus, „dass das Bauen im Bestand, also das Sanieren, Umnutzen, Umbauen und Erweitern von bestehenden Gebäuden, in fast allen Fällen die bessere Lösung ist als das [sic] Abriss und Ersatzneubau“. Durch Sanierung statt Neubau ließe sich ca. ein Drittel der schädlichen CO2-Emissionen einsparen. Zudem stamme mehr als die Hälfte des deutschen Abfallaufkommens aus der Baubranche, welche Schätzungen der Deutschen Umwelthilfe zufolge jährlich etwa 3,3 Millionen Tonnen CO2 durch Abriss und Neubau ausstoße. Mehr Sanierung statt Abriss und Neubau wäre somit nicht nur besser fürs Klima, sondern könnte bestehenden Wohnraum für Menschen mit geringeren Einkommen schützen.
Schließlich werden auch entsprechende Rahmenbedingungen auf dem Arbeitsmarkt benötigt, damit Erwerbstätige in Vollzeit oder vollzeitnahen Teilzeitstellen durch ihre Arbeit ihren Lebensunterhalt – einschließlich der Miete – selbstständig finanzieren können, ohne dadurch in finanzielle Engpässe zu geraten. Angefangen von besserer Qualifizierung im Bereich Ausbildung/Übergänge, bis zu einer stärkeren Förderung von Fachkräften und einer besseren und gerechteren Entlohnung angesichts steigender Preise in vielen Bereichen des täglichen Lebens. Letzteres schließt bei tarifgestützter Vergütung nicht nur die Berücksichtigung regionaler Besonderheiten ein, sondern auch geschlechterspezifischen Lohnunterschieden muss entscheidend entgegengewirkt werden: Gleiches Gehalt für gleiche Arbeit sollte die Prämisse sein.
Autorin: Mareike Klemz