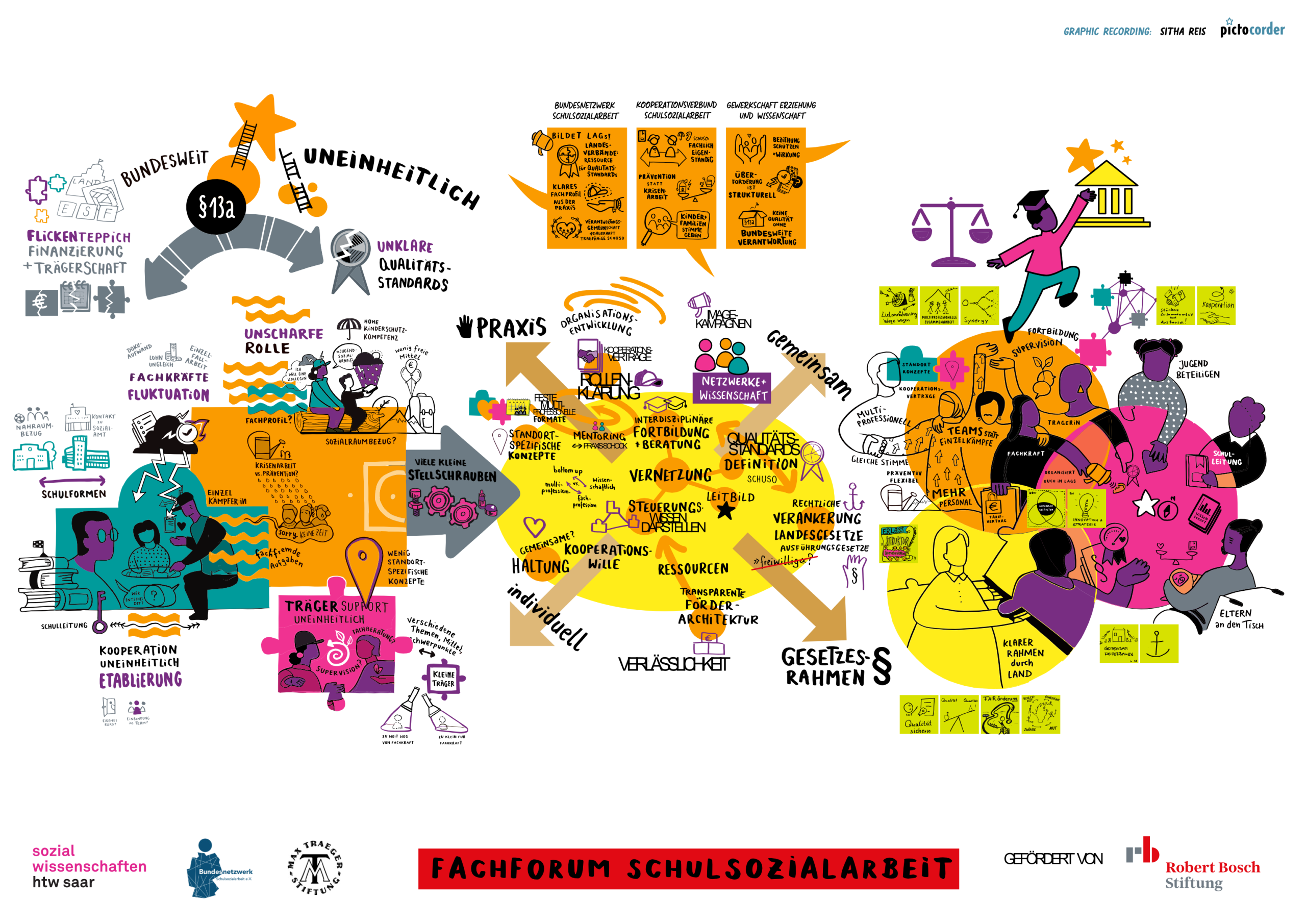Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die der Schule fernbleiben, ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Aktuelle Studien zeigen, dass es sich bei Schulabsentismus um ein vielschichtiges Phänomen handelt, das durch eine Vielzahl unterschiedlicher, teils miteinander verknüpfter Faktoren bedingt und aufrechterhalten wird. Sowohl im Bildungsbereich als auch in der Sozialen Arbeit, vor allem in der schulbezogenen Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit, existiert eine Vielzahl an bewährten Konzepten und Beispielen zum Umgang mit Schulabsentismus – jedoch nicht flächendeckend an allen Schulen. Allerdings fehlt ein Überblick an eben jenen guten Beispielen und Angeboten als Orientierung in der Prävention von und Intervention bei Schulabsentismus.
Die Interviewreihe „Schulabsentismus begegnen – aber wie?!“ möchte dem entgegenwirken: Monatlich wird ein ausgewähltes Praxisbeispiel aus der Jugendsozialarbeit vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen dabei Projekte und Maßnahmen, die junge Menschen individuell begleiten und sie darin unterstützen, ihren Weg zurück ins Bildungssystem oder gegebenenfalls einen alternativen Bildungsweg zu finden – mit dem Ziel, ihnen gesellschaftliche Teilhabe (wieder) zu ermöglichen. Fachkräfte der einzelnen Angebote geben Einblick in ihre Arbeit und zeigen Herausforderungen sowie die aus ihrer Sicht maßgeblichen Gelingensbedingungen auf. Die Gesprächspartner*innen sind Teilnehmende des Projektes „Schule – ohne mich!? Neue Entwicklungen und Handlungsanforderungen bei Schulabsentismus“ von IN VIA Deutschland im Netzwerk der Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit.
Für diese Ausgabe der Interviewreihe sprach Lierin Hanika vom Projekt Oktopus der Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz mit den Jugendsozialarbeit News.
Wie zeigt sich das Phänomen Schulabsentismus in Ihrer Region?
Lierin Hanika: Das Thema Schulabsentismus tritt im Landkreis Ludwigsburg in unterschiedlichsten Facetten auf. Anhand interner Projektstatistik ergibt sich bei allen erfassten schulaversiven Schüler*innen eine Verteilung von ca. 76 % Schüler*innen mit einer Schulangst/ Vermeidungssymptomatik, 33 % latente Fehlzeiten/ Schwänzen, 18 % passive Unterrichtsvermeidung und 21 % aktives Störverhalten im Unterricht. Als mögliche Folge kann es zu Schulausschlüssen oder gar Schulabbrüchen kommen.
Wo setzt Ihr Projekt bzw. Ihr Angebot an?
Lierin Hanika: Das Projekt Oktopus setzt direkt bei den betroffenen Kindern und deren Angehörigen an. Hierfür wird das Familiensystem besonders berücksichtigt, wodurch die im Tandem stattfindende Elternarbeit eine große Rolle in der Beratung spielt. Die spezifischen Anliegen und Bedürfnisse der Betroffenen werden zunächst erfasst und individuelle kurz- bis langfristige Unterstützungsmöglichkeiten erarbeitet.
Eltern und Angehörige sollen gezielt in ihrer Kompetenz und Handlungsfähigkeit gestärkt werden, um eine haltgebende Struktur für die betroffenen Kinder und Jugendliche schaffen zu können. Gleichzeitig werden die jungen Menschen anhand ressourcenorientierter Einzelfallhilfe in ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt. Hierbei werden außerschulische Erfolgserlebnisse initiiert oder gefördert, damit die Betroffenen von dieser auch bei schulischen Herausforderungen profitieren können. Ziel ist neben der (Wieder-) Herstellung des psychosozialen Wohlbefindens vor allem das Finden eines adäquaten Lernortes, die Stabilisierung des Schulbesuchs und ggf. das Erreichen eines Bildungsabschlusses.
Neben den betroffenen jungen Menschen und Angehörigen setzt das Projekt seit Januar 2025 auch gezielt bei den Fachkräften an, um dem Thema Schulabsentismus präventiv entgegenzuwirken. Hierfür werden neben telefonischen Beratungen explizit kollegiale Fallberatungen für betroffene Fachkräfte angeboten, damit diese in ihrer praktischen Arbeit direkt erste Handlungsideen umsetzen können. Zudem erreicht das Projekt anhand von Fachvorträgen und Fachtagen ein breites Publikum, um für das Thema zu sensibilisieren.
Was gelingt aus Ihrer Sicht besonders gut?
Lierin Hanika: Auf der Basis der einjährigen Betreuungszeit gelingt es bei aktiver Mitwirkung, eine wertschätzende und tragfähige Arbeitsbeziehung zur Klientel aufzubauen. Anhand dieser können Systemhemmnisse abgebaut und die Betroffenen in andere Hilfssysteme überführt und begleitet werden. Dank jahrelanger Fachexpertise und Netzwerktätigkeit gelingt dem Projekt eine gewinnbringende Zusammenarbeit sowohl im klinisch-psychiatrischen Bereich als auch mit der Jugendhilfe. Dadurch ist eine Vor- und Nachbetreuung, aufsuchende Begleitung, sowie eng verzahnte Zusammenarbeit möglich.
Welche Herausforderungen zeigen sich?
Lierin Hanika: Herausforderungen ergeben sich beispielsweise daraus, dass wir nicht alle betroffenen Zielgruppen erreichen können, wodurch Grundschulen und Berufsschulen im Landkreis leider unversorgt bleiben. Das Interesse und der Bedarf an Maßnahmen wie Oktopus hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Dies machen wir daran fest, dass wir 2023 zum ersten Mal eine Warteliste einführten, welche wir teilweise sogar schließen mussten, da die Fallanfragen die Kapazität überschritten. Wir führen dies auf multikomplexe Problemlagen mit einem einhergehenden Zuwachs an psychischen Erkrankungen und Zukunftsängsten zurück.
Nicht unerwähnt soll an dieser Stelle bleiben, dass unser Projekt das einzige in dieser Form im Landkreis Ludwigsburg ist. Wir sind dankbar für die Förderung durch den Europäischen Sozialfonds (ESF). Gleichzeitig bemühen wir uns jetzt schon um alternative Fördermöglichkeiten, die unserem Projekt eine langfristige und auskömmliche Planbarkeit ermöglichen, sollte die Förderung des ESF auslaufen.