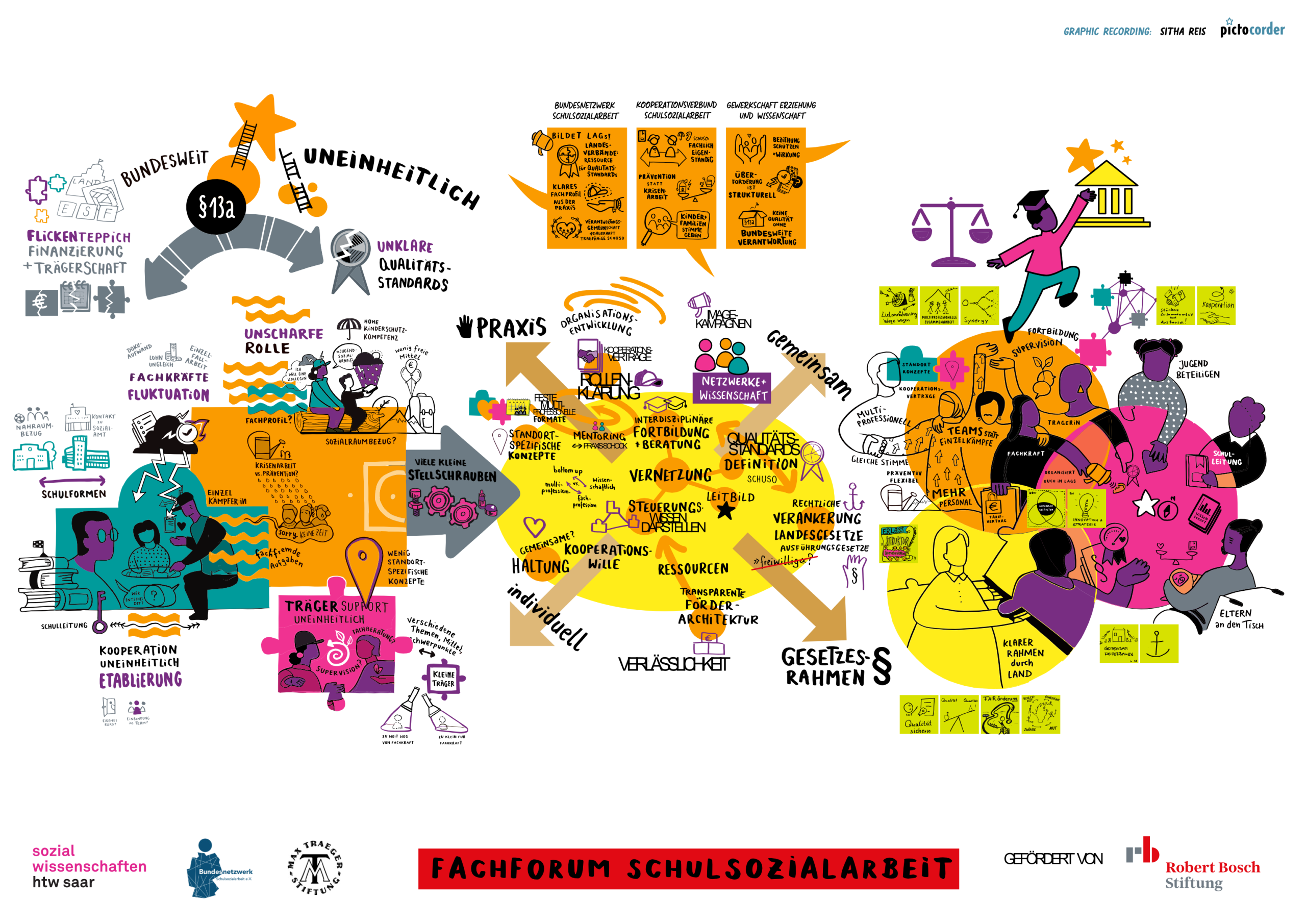In der politischen Debatte über eine Reform der Grundsicherung sind sie die zentrale Gruppe als Argument für Kürzungen: die Totalverweigerer. Diese Gruppe steht stellvertretend für Leistungsempfänger*innen im Fokus und soll nach dem Willen von CDU, CSU und SPD drastisch sanktioniert werden. Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hat dieser Gruppe nachgeforscht – und sie nicht gefunden. „Viel Lärm um nichts?“, fragen die Autor*innen und geben als Antwort: Die Hinweise sprechen für eine extrem geringe Anzahl von Leistungsminderungen nach §31a Abs. 7 SGB II.
Das Bild mangelnden Mitwirkens von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten bis zur Maximalausprägung des Totalverweigerers sei eine beständige Begleitung, die den Diskurs ebenso wie die beobachtete Praxis von Vermittlungsfachkräften in den Jobcentern präge, bilanzieren die Autor*innen der Studie und stellen klar: „Damit wird ‚der Totalverweigerer‘ zum Scheinriesen: Aus der Ferne – vermittelt über Zeitungsartikel oder in abwertenden Urteilen über bestimmte Gruppen von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten – wirkt es, als wäre er vielzählig und daher eine Gefahr für die Finanzierbarkeit der Grundsicherung“. Mit Bezug auf die Statistik der Bundesagentur für Arbeit liegen laut IAB jedoch keine qualitätsgesicherten Daten zur Anzahl vor.
Wandel zur Skandalisierung
Die Studie entzieht der Debatte nicht allein das Feindbild. Sie zeichnet den Wandel von der Unterstützung für Armutsbetroffene und deren Skandalisierung als „Hartzer“ (nach den Hartz-Reformen der Agenda 2010) nach. Sie beschreibt die darauffolgende Anerkennung von Leistungsberechtigten zurück zur Figur des Totalverweigerers – erfunden vom ehemaligen Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD).
Hervorgegangen ist die heutige Existenzsicherung aus der Armenhilfe. Im Wohlfahrtsstaat wurde ein enges Netz aus Sozialversicherungen geknüpft, in dem neben Sozialversicherungen (zum Beispiel bei Arbeitslosigkeit, Rente, Krankheit und Pflege) unter anderem aus Steuergeldern ein menschenwürdiges Leben durch eine Grundsicherung sichergestellt wurde. Einen zentralen Paradigmenwechsel sehen die Autor*innen der Studie durch den Neoliberalismus zum Ende der 1990er Jahre: Sozialleistungen wurden vor dem Hintergrund wachsender Bedürftigkeit und belasteter Staatskassen als Hemmnisse für Wirtschaftswachstum gedeutet. Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die aus unterschiedlichen Gründen (Alter, Erziehungs- oder Care-Arbeit, Gesundheitszustand, Aufenthaltsstatus) nicht für den Arbeitsmarkt aktiviert werden konnten und weiter Leistungen bezogen, wurden zum Antipoden des Steuerzahlers, der alimentieren muss. Dieses Gegeneinander wird politisch gepflegt, um Verantwortung im Sozialstaat zu verschieben. Und dieses Bild prägt nach der Analyse des IAB zunehmend Mitarbeitende in den Jobcentern, die Leistungsempfänger*innen gegenübersitzen – und deren Leistungsberechtigung zunehmend angezweifelt wird.
Gespenst in Talkshows
Die Studie skizziert ausführlich den Diskursverlauf der vergangenen 20 Jahre und setzt einen Schwerpunkt auf die Zeit der 20. Legislatur, in der vor allem die SPD mit dem Bürgergeld ihre Geschichte der Agenda 2010 neu schreiben wollte. Das Ergebnis kann täglich in Medien rezipiert werden: Der Totalverweigerer sitzt als Gespenst in nahezu jeder politischen Talkshow und spukt durch Leitartikel zur Reform des Sozialstaats.
Text: Michael Scholl