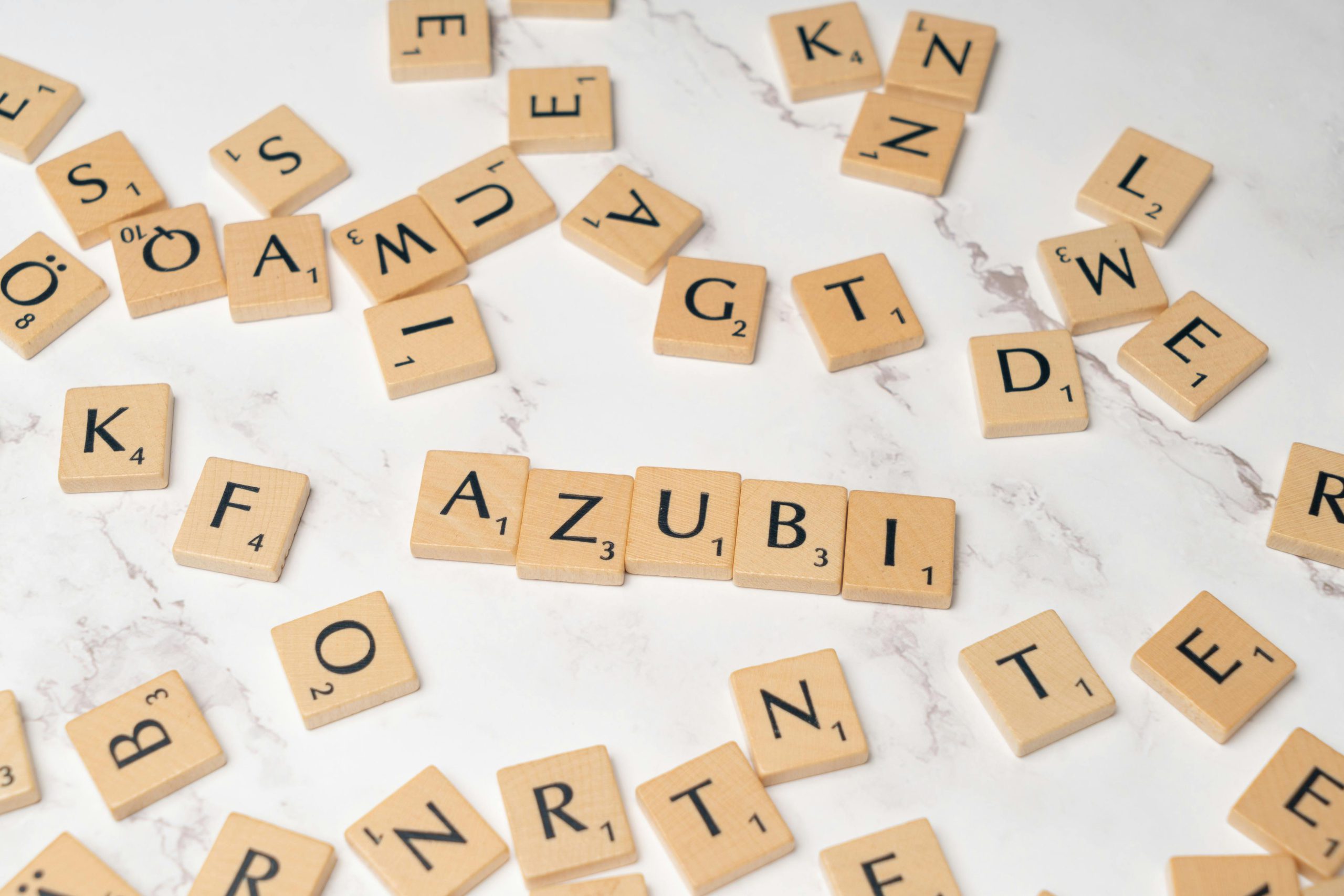„Generationsübergreifende Gerechtigkeit ist ein gesellschaftliches Querschnittsthema– es betrifft uns alle, aber vor allem junge Menschen.“ Diese Aussage von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im September 2024 ist zugleich der thematische Aufhänger des Positionspapiers des Europäischen Jugendforums (European Youth Forum – EYF) vom Juni 2025, das sich mit Fragen intergenerationeller Gerechtigkeit auseinandersetzt. Aus Sicht des EYF besteht der Kerngedanke einer generationenübergreifend gerechten Welt darin, dass die Herausforderungen, Realitäten und Ideen junger Menschen anerkannt werden und ihre Rechte, Möglichkeiten und Ressourcen im Zentrum politischer Entscheidungen stehen.
Dabei gelte es, sechs Grundprinzipien zu beachten:
- Die verschiedenen Generationen und ihre spezifischen Herausforderungen anerkennen
- Rechte junger Menschen ernst nehmen
- Zukunftsorientiertes Denken
- Intragenerationelle Ungleichheit bekämpfen
- Faire und nachhaltige Investitionen
- Generationsübergreifenden Austausch und Verständnis fördern
Insbesondere der letzte Aspekt der Förderung des generationsübergreifenden Austausches und Verständnisses ist dabei für die Jugendsozialarbeit (JSA) besonders interessant. Wichtig ist für die JSA in diesem Kontext, sich zukünftig generationsübergreifender aufzustellen, inklusiver zu werden und zu denken – mehr Raum für Begegnung und Dialog zwischen den Generationen zu ermöglichen. Auf europäischer Ebene bedeutet dies folglich: Es bedarf nicht nur mehr interkulturellen Austausch, Begegnungen und Verständnis zwischen jungen Menschen, sondern auch intergenerationell. Intragenerationelle Gerechtigkeit anzustreben ist dabei ein wichtiger Aspekt: auch die Bedürfnisse und Lebensgrundlage der derzeit lebenden Alters- und Bevölkerungsgruppen gilt es zu berücksichtigen und sicherzustellen. Vor allem vulnerablere und von Beeinträchtigung betroffene Gruppen müssen an dieser Stelle besonders in den Blick genommen werden.
Mehr Macht durch Masse?
Es lässt sich nicht leugnen, dass die sogenannte Boomer-Generation in Deutschland allein zahlenmäßig klar hervorsticht und sie als Nachkriegsgeneration die soziale und politische Landschaft stark mitgeprägt haben, in der wir heute leben. Angesichts der demographischen Entwicklung hierzulande kommt dieser Generation die quantitative größte Bedeutung zu. Jüngere Altersgruppen unter 30 Jahren sind laut einer Erhebung des statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2023 deutlich schwächer vertreten. Mehr noch: je niedriger das Alter, desto geringer die Bevölkerungsanzahl der jeweiligen Altersgruppe. Naheliegendes Fazit: mehr Macht durch mehr Masse. Die Verhältnisse und Fronten sind geklärt.
Wenngleich es an dieser Stelle allein aufgrund des zahlenmäßigen Ungleichgewichts definitiv einer machtkritischen Betrachtung bedarf, da sich dieses selbstredend auch in Stimmanteilen bei (politischen) Entscheidungsprozessen widerspiegelt, sollte hierbei vielmehr Folgendes betont werden: Wir brauchen einander. Nicht nur die „Jungen“ die „Alten“, weil jene politisch einflussreicher sind und somit mehr Macht haben. Sondern auch umgekehrt. Und in verschiedensten Bereichen. Zu nennen wäre dabei u. a. die Finanzierung der Rente, Kranken- und Pflegeversicherung, Kinderbetreuung, Transformation der Arbeitswelt durch KI, fortschreitende Digitalisierung oder die Folgen des Klimawandels. Die Liste ließe sich leicht fortsetzen. Allein aufgrund ihrer unterschiedlichen Alter haben die jeweiligen Generationen teilweise sehr unterschiedliche gesellschaftliche Entwicklungen und Prozesse miterlebt und Erfahrungen gesammelt. Dies führt zu unterschiedlicher Expertise und Präferenzen, Stärken und Schwächen, aber beeinflusst ganz einfach auch die eigene Sicht auf verschiedene Themen. Doch nicht jede*r innerhalb einer Generation hat dieselben Erfahrungen gemacht, denn eine Generation ist weder eine homogene Gruppe noch ist sie in der Regel einfach und klar definier- und abgrenzbar. Vielmehr repräsentiert sie ein breites Spektrum an (sozialen) Hintergründen, Interessen und Altersgruppen.
Brückenbauen zwischen den Generationen
Gesamtgesellschaftlich betrachtet leben wir heute mehr nach Altern getrennt als je zuvor in der Geschichte der Menschheit, resümieren die Autor*innen des EYF-Papiers. Denn jüngere und ältere Menschen nähmen häufig unterschiedliche physische und virtuelle Räume ein. Hinzukommen altersbedingte Stereotypen, oftmals verstärkt durch die Medien, die sich meist eher darauf konzentrieren, Generationen gegeneinander aufzuspielen, anstatt jüngere und ältere Menschen zusammenzubringen. Doch für eine generationenübergreifende, faire Gesellschaft ist es unerlässlich, Dialog und Verständnis zwischen den Generationen wiederherzustellen und zu fördern – auch mit und durch Jugendorganisationen. Das EYF empfiehlt hierfür neben generationsübergreifenden Aktivitäten, die zeitgleich den kulturellen Austausch fördern, auch Mentoringprogramme und den Austausch zwischen Organisationen auf europäischer Ebene. Nationale Jugendräte und ihre Partnerorganisationen, die verschiedene Altersgruppen vertreten, sollten dabei in den Dialog miteinander treten und gemeinsame Projekte durchführen, um das gegenseitige Verständnis und die Zusammenarbeit zu fördern. Aus Sicht des EYF ist zudem wichtig, dass politische Entscheidungsträger*innen die Freiwilligenarbeit von Jugendorganisationen formal anerkennen und finanziell unterstützen, die Projekte für generationsübergreifendes Lernen und Austausch fördern. Auch altersbedingte Stereotypen gelte es zu entkräften und durch positive Beispiele zu widerlegen, die die Zusammenarbeit zwischen Europäer*innen unterschiedlichen Alters aufzeigen. Denkbar sei, hierfür den europäischen Tag der Solidarität zwischen den Generationen am 29. April zu nutzen.
Im Fazit des Positionspapiers heißt es: „Junge Menschen verdienen eine generationenübergreifend gerechte Welt, in der sie Zugang zu gleichen und umfassenden Chancen haben – ohne durch strukturelle, generationenbedingte oder ökologische Herausforderungen gehemmt zu werden.“ Um dies zu erreichen, braucht es mehr Verständnis, Dialogbereitschaft, Austausch und Begegnung. Nicht nur für und unter jungen Menschen, sondern inklusiver und generationsübergreifend. Für mehr intergenerationelles Miteinander statt Gegeneinander.
Autorin: Mareike Klemz