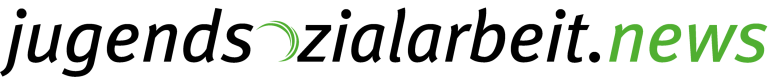INTEGRATON UNTER VORBEHALT Perspektiven junger Erwachsener mit Migrationshintergrund Wie junge Erwachsene mit Migrationshintergrund Integration erleben und verstehen, steht im Mittelpunkt der von Dr. Barbara Schramkowski an der Universität Oldenburg durchgeführten Untersuchung mit dem Titel �Integration unter Vorbehalt’. Hier wird einmal nicht aus einer �deutschen Mehrheitsgesellschaftsperspektive’ über Personen mit Migrationshintergrund und ihre Integration gesprochen bzw. diese problematisiert und als defizitär dargestellt. Statt dessen werden, ausgehend von den Aussagen der jungen Erwachsenen, Vorschläge für eine konstruktive Ausgestaltung von Integration entwickelt und ausgrenzende Strukturen sowie ethnisierende Zuschreibungen als positive Integrationsverläufe behindernde Faktoren in den Mittelpunkt gerückt. Im Rahmen der qualitativen Untersuchung wurden sechzehn Personen im Alter von 19-26 Jahren zu ihren Erfahrungen im Integrationsprozess, ihren Assoziationen mit dem Begriff sowie zu ihrer subjektiven Integrationsempfinden befragt. Acht InterviewpartnerInnen sind türkischer Herkunft und bereits in Deutschland geboren. Die andere Hälfte sind (Spät-)AussiedlerInnen, die im Alter von neun bis 18 Jahren nach Deutschland immigriert sind. Sie sind jeweils zu gleichen Teilen männlich und weiblich, haben unterschiedlichste familiäre Hintergründe und Bildungsabschlüsse (vom Hauptschulabschluss zum Abitur). Einige studieren zum Interviewzeitpunkt noch, andere haben eine Ausbildung gemacht und arbeiten bereits. Der Kontakt zu diesen jungen Erwachsenen kam über im Vorfeld interviewte Experten mit Migrationshintergrund, die in der Sozialen Arbeit mit Eingewanderten tätig sind und/ oder Migrantenvereine leiten, zustande. Diese hatte die Autorin gebeten, ihr Kontakte zu jungen Erwachsenen zu vermitteln, deren Integration sie als positiv beurteilen. Diese Bewertungen wurden v.a. an den Deutschkenntnissen, den Bildungsbiografien oder der deutschen Staatsbürgerschaft festgemacht und somit an Indikatoren, an denen Integrationserfolge auch seitens der Mehrheitsgesellschaft bemessen werden. Ihre Aussagen zeigen jedoch, dass sich die Mehrheit der Befragten infolge des Vorbehalts der Anerkennung ihrer Zugehörigkeit als gleichberechtigte Gesellschaftsmitglieder nicht oder nur eingeschränkt integriert und sich somit der Gesellschaft, in der sie faktisch Zuhause sind, nur bedingt oder auch gar nicht zugehörig fühlt. Alltagsrassistische Zuschreibungen und Ausgrenzungen in den verschiedenen Lebenskontexten signalisieren ihnen, dass sie ohne Berücksichtigung ihrer individuellen Orientierungen und Lebenslagen von Teilen der Mehrheitsgesellschaft weiter als �integrationsbedürftige Ausländer’ definiert werden. Diese Alltagsrassismen (vgl. u.a. Leiprecht 2001) schlagen sich in den unterschiedlichsten, für Außenstehende oft nicht erkennbaren Formen in den gesellschaftlich-institutionellen Strukturen der Gesellschaft, in Denkmustern und Handlungen ihrer Mitglieder im öffentlichen und privaten Raum sowie in dominanten Diskursen nieder. Sie machen die jungen Erwachsenen auf die die alltäglich spürbaren Trennlinien zwischen Personen mit und ohne Migrationshintergrund aufmerksam und führen ihnen vor Augen, dass sie trotz ihrer langjährigen Aufenthaltsdauer und obwohl sie gesellschaftlich angesetzte Indikatoren erfolgreicher Integration erfüllen, für die Mehrheitsgesellschaft, wie eine Interviewpartnerin formuliert, „doch etwas Anderes, etwas Fremdes […], ja ein Mensch zweiter Klasse“ bleiben. Diese Erfahrungen haben – so ein Ergebnis der Untersuchung – dazu geführt, dass ein Teil der Befragten sich mittlerweile deutlich von der �deutschen’ Gesellschaft abgrenzt und ausschließlich die Zugehörigkeit zum Herkunftskontext (der Eltern) hervorhebt. Genauso haben die Ausgrenzungserfahrungen, wie zuerst erläutert wird, dazu beigetragen, dass ein großer Teil der Befragten Integration mittlerweile primär als negativ konnotierten Terminus wahrnimmt. Auszüge aus der Studie: “ 1 ZUR DOMINANZ NEGATIVER ASSOZIATIONEN MIT �INTEGRATION’ In der wissenschaftlichen Fachliteratur sowie in gesellschaftspolitischen Stellungnahmen wird Integration zumeist als eine positive Zielvorstellung dargestellt. Dabei werden u.a. die gleichberechtigte Partizipation von Eingewanderten an gesellschaftlichen Strukturen und die Anerkennung ihrer gesellschaftlichen Zugehörigkeit mit ihren ethnischen Mehrfachbezügen als Kernelemente der Integration dargestellt. Die Sichtweisen der jungen Erwachsenen verdeutlichen jedoch, dass diese den Integrationsbegriff vorwiegend negativ sehen und zeigen dabei, dass die in wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Diskursen formulierten Elemente der Integration keine Bestandteile der von den jungen Erwachsenen erlebten Realität bilden. Beispielsweise nehmen diese wahr, dass der Begriff Integration instrumentalisiert wird, um Eingewanderten die Verantwortung für bestehende Probleme der Integration zuzuweisen. Diese werden nämlich mit ihrer angeblich fehlenden Bereitschaft zur Integration oder den nicht vorhandenen Deutschkenntnissen erklärt. Rassistische Denk- und Handlungsmuster hingegen und somit Faktoren, die im Verantwortungsbereich der �deutschen’ Gesellschaft liegen, finden kaum Erwähnung. Des Weiteren fällt den jungen Leuten immer wieder auf, dass im öffentlichen Diskurs ein Verständnis von Integration dominiert, dass diese als einseitige, von Eingewanderten zu erbringende Assimilationsleistung an die �deutsche Kultur’ interpretiert. Immer wieder hören sie den Kommentar: „Ihr müsst euch anpassen.“ Darüber hinaus stellen die Befragten fest, dass durch mit dem Diskurs um Integration vielfach einhergehende scheinbar �selbstverständliche’ Argumentationsmuster in den dichotomen Kategorien �Deutsche – Ausländer’ und der hiermit verbundenen Unterscheidung zwischen Personen, die als zur Gesellschaft zugehörig gesehen, und solchen, die als nicht zugehörig gelten, ethnisierende Trennungslinien verstärkt werden. Somit tragen Integrationsdebatten, wie eine der jungen Frauen äußert, zu einer Festigung von Ausgrenzungen bei: „Für mich aber hat dieses Integrationswort mit der Zeit seinen Wert verloren, und es ist jetzt ein negatives Wort, weil durch das Wort Integration werden […] diese Ausgrenzungen gemacht. Du bist das, und du bist das.“ Auch fällt den jungen Erwachsenen auf, dass der Begriff Integration von der Mehrheitsgesellschaft teilweise instrumentalisiert wird, um von ihrer eigenen Verantwortung für Integrationsdefizite abzulenken und diese einseitig auf Seiten der Eingewanderten zu lokalisieren. Dabei werden beispielsweise die fehlenden Bemühungen um Integration als Erklärungskategorien für sämtliche, mit Integrationsprozessen verbundene Schwierigkeiten wie die proportional schlechte Bildungssituation von Personen mit Migrationshintergrund oder die Entwicklung so genannter Parallelgesellschaften funktionalisiert. Entsprechende Erklärungsmuster verschleiern nämlich, dass auch alltagsrassistische Zuschreibungen und Ausgrenzungspraxen sowie langjährige defizitäre Angebote der Integrationsförderung und somit genauso Handlungspraxen der aufnehmenden Gesellschaft zur Entwicklung von Ungleichheiten und Abgrenzungstendenzen Eingewanderter beigetragen haben. Insofern verliert sich die Gesellschaft, wie die jungen Erwachsenen beanstanden, in einer Debatte über Symptome defizitärer Integration, ohne hinter diesen stehende Ursachen umfassend zu analysieren. Überdies nehmen die Interviewten – ungeachtet ihrer im Sinne angeblich objektiv gültiger Indikatoren erfolgreichen Integration und dem Umstand, dass sie mehrheitlich die deutsche Staatsbürgerschaft innehaben – ihre Integration als unsicher wahr. Infolge alltagsrassistischer Erfahrungen in verschiedenen Lebenskontexten ist v.a. den jungen Erwachsenen türkisch-muslimischer Zugehörigkeit bewusst, dass ihre gesellschaftliche Zugehörigkeit beispielsweise infolge von Arbeitslosigkeit oder öffentlicher Negativdiskurse über Fundamentalismus im Islam wieder revidiert oder zumindest in Frage gestellt werden kann bzw. aktuell bereits wird und sie beispielsweise wieder als Bedrohung für die Sozialsysteme konzeptionalisiert werden. Die latent empfundene Bedrohung durch einen möglichen gesellschaftlichen Ausschluss ist neben einer generellen Sorge vor Ausgrenzungen mit belastenden Unsicherheitsgefühlen verbunden. Diese spitzen sich in der Angst vor dem Verlust der Aufenthaltsberechtigung und einer hieraus resultierenden Abschiebung aus Deutschland zu. Diese beschreibt eine der Interviewpartnerinnen: „Man hat immer das Gefühl, es ist nie Schluss. Vielleicht schmeißen sie uns irgendwann aus Deutschland raus. Man hat dadurch, dass man nicht deutsch ist, auch wenn man die deutsche Staatsbürgerschaft hat und jahrelang hier gelebt hat, die deutsche Sprache sehr gut beherrscht, hier was aufgebaut hat, das Gefühl, vielleicht werden wir ja mal irgendwann abgeschoben.“ Sie fährt fort: „Immer hört man irgendwas, immer wird man damit konfrontiert. […] Ausländergesetze, das hört man auch so oft. Dann sagt man, stimmt ja, du bist ja hier als Ausländer. Vielleicht irgendwann machen sie irgendein Gesetz, ihr müsst jetzt zurück. […] Und was machen wir dann dort?“ Weil öffentliche Diskurse ihr immer wieder die nicht vorhandene Selbstverständlichkeit der dauerhaften gesellschaftlichen Zugehörigkeit von Personen mit Migrationshintergrund aufzeigen, zweifelt sie mittlerweile die Richtigkeit der Entscheidung ihrer Familie für eine Einbürgerung an: „War das eigentlich das Richtige, dass unsere Eltern das gemacht haben? Schmeißen die uns jetzt raus […] aus der deutschen Staatsbürgerschaft?“ Die signifikanten Differenzen zwischen den in gesellschaftspolitischen Diskurs formulierten Zielen der Integration und der von den Befragten wahrgenommenen Realität haben dazu beigetragen, dass einige die zahlreichen Diskussionen über das Thema mittlerweile als „Heuchelei“ auffassen: Ihre Ansicht nach wird das Konzept Integration eher gegen als zum Wohl von Eingewanderten eingesetzt, solange diese trotz langjähriger Aufenthaltsdauer und objektiver Integration weiter als �Ausländer’ dargestellt und behandelt werden. 2 SEGREGATIV-REETHNISIERENDE TENDENZEN BEI EINIGEN DER BEFRAGTEN Infolge alltagsrassistischer Erfahrungen in verschiedenen Bereichen, die ihnen den Vorbehalt der Anerkennung ihrer gesellschaftlichen Zugehörigkeit aufzeigen, sehen die jungen Erwachsenen mittlerweile keine Handlungsoptionen mehr für die Fortentwicklung ihres Eingliederungsprozesses. Sie sind die ihnen möglichen Schritte gegangen, um sich zu integrieren. Deshalb meint eine der jungen Frauen: „Ich weiß nicht, was sie (Angehörige der Mehrheitsgesellschaft Anm. B.S.) wollen. Es fehlt nur noch, […] dass wir unsere Haare auch färben und blond rumlaufen sollen, wenn es diese Übersetzung (von Integration Anm. B.S.) ist. Ich finde, mehr kann man doch nicht machen.“ Vor diesem Hintergrund sind die InterviewpartnerInnen mehrheitlich zu der von einer der Befragten pointiert skizzierten Überzeugung gelangt: „Du kannst tun und lassen, was du willst, du bist eine Ausländerin, du bleibst eine Ausländerin.“ Dabei begleitet die Empfindung, nicht als gleichberechtigte Gesellschaftsmitglieder akzeptiert zu werden, viele – wie einer der jungen Männer anhand eines konkreten Beispiels beschreibt – schon seit der Kindheit: „Als Kind habe ich das schon gemerkt. Man hat allen irgendwie gedankt, und man wünscht allen etwas. […] Man kann doch auch sagen, wir wünschen auch den Andersgläubigen in der Weihnachtszeit […] alles Gute vom Herzen. Die haben auch einen Beitrag geleistet, dass wir so weit gekommen sind. Die Akzeptanz, das ist nicht da. Das wird nicht honoriert. Kein bisschen Anerkennung für unsere geleistete Arbeit. Wenn der (ehemalige Bundeskanzler Anm. B.S.) Kohl die Neujahrsansprache gemacht hat, nicht ein Wort, wir danken auch mal unseren ausländischen Leuten.“ Die Reflexion dieser Erfahrung berührt einige der jungen Erwachsenen sehr, und sie konstatieren: „Mit der Zeit macht es einen schon fertig“. Auf dieser Basis fällt es ihnen schwer, eine Heimat-Identifikation mit dem Land, das schon seit vielen Jahren bzw. seit der Geburt ihr Lebensmittelpunkt ist, aufzubauen. Dennoch sind die Befragten infolge ihres Wunsches nach Aufnahme als gleichberechtigte Gesellschaftsmitglieder über verschiedenen Wege mehrheitlich weiter bemüht, die ersehnt Zugehörigkeitsanerkennung zu erlangen. Einige versuch(t)en v.a. als Kinder und Jugendliche sich an als �deutsch’ interpretierte Denk- und Handlungsmuster zu assimilieren. Andere bekennen sich trotz gesellschaftlicher Ausschlusspraxen und ethnisierender Rollenzuschreibungen mittlerweile zu ihrem ihren Mehrfachzugehörigkeiten: Sie zeigen ihre Zugehörigkeit zum Herkunftskontext (der Eltern) und sehen sich gleichzeitig (wenn auch eher eingeschränkt) als dem Aufnahmekontext zugehörig. Doch empfinden sie immer wieder, dass sie von der aufnehmenden Gesellschaft nicht als zugehörig angesehen werden. Zwei der Befragten – Murat und Cem – reagieren auf die langjährige verletzende Empfindung, trotz ihrer Bemühungen „nicht richtig aufgenommen zu werden, so wie’s sein müsste“, indem sie sich inzwischen betont von der �deutschen’ Gesellschaft distanzieren und ausschließlich ihre Zugehörigkeit zum Herkunftskontext (der Eltern) hervorheben. Beide berichten, dass sie über Jahre versucht haben, die ersehnte Zugehörigkeitsanerkennung durch Assimilation zu erlangen und sich somit zu integrieren: „Ich hab dafür (für Integration Anm. B.S.) eigentlich viel geleistet, würde ich sagen. Integriert wird man aber nur, wenn man aufgenommen wird. Wenn man nicht aufgenommen wird, kann man sich gar nicht integrieren, ist sehr schwer. Und deshalb fühle ich mich nicht integriert. Also, ich wollte mich wirklich integrieren. Und mit der Zeit ist es mir jetzt egal. Ich bin jetzt auch stolz, dass ich Türke bin.“ Als ausschlaggebend für ihre Abgrenzung von der Mehrheitsgesellschaft benennen beide kontinuierliche Alltagsrassismen: „Das sind solche Faktoren, die einen zum Rasen bringen. Dann schluckst du und schluckst, und eigentlich schluckst du immer, jeden Tag. Es sind kleine Schlücke, aber es wird irgendwann einmal voll, und dann drehst ab. […] Also ich muss sagen, ich war anders. Ich bin aber ein bisschen radikaler geworden, […] weil ich mich bei euch nicht aufgenommen fühle, wenn ihr mich immer als diese Person abstempelt.“ Mittlerweile verdeutlichen Aussagen wie „Ich habe zwar die deutsche Staatsangehörigkeit, […] aber ich fühle mich kein bisschen deutsch.“, dass Murat und Cem mit ihrer Selbstdefinition als �Türke’ oder �Ausländer’ gesellschaftlich vorherrschende, in erster Linie negativ konnotierte Fremd(heits)zuschreibungen in ihr Selbstverständnis umgewandelt haben. Zugleich messen sie islamischen Orientierungen mehr Bedeutung bei, suchen verstärkt Kontakt zu Personen des Herkunftslands und bemühen sich, auf eine Verbesserung der gesellschaftlichen Position von Eingewanderten hinzuwirken: „Man hat einfach immer versucht […], der liebe Türke von nebenan zu sein, ganz anders als die anderen. […] Und jetzt bin ich halt so weit, dass ich wenigstens versuche, den Draht zu meinen Leuten nicht zu verlieren. Und ich bin jetzt im türkischen Verein, und [….] ich möchte mich jetzt engagieren für unsere Leute.“ Die verstärkte Reethnisierung und die hiermit verbundene Orientierung am Herkunftskontext bzw. der Rückzug in die Herkunftsgruppe ermöglichen ihnen, den Migrationshintergrund endlich positiv zu konzeptionalisieren und helfen ihnen insofern bei der Verarbeitung von alltagsrassistischen Erfahrungen. Dabei fällt auf, dass Murat und Cem die �deutsche’ Gesellschaft inzwischen mehrheitlich als eine Eingewanderten gegenüber pauschal ablehnend eingestellte Gruppe sehen. Dieser selektive Wahrnehmungsfokus könnte dazu beitragen, dass sich die oft bereits bestehende soziale Distanz zwischen Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft und Personen aus Einwanderergruppen sowie die hiermit vielfach einhergehende gegenseitige Ablehnung weiter verfestigen. Beidseitiges Denken und Reden in ethnischen Trennungskategorien, indem also Eingewanderte verstärkt von �den Deutschen’ und Angehörige der Mehrheitsgesellschaft von �den Ausländern’ reden, tragen dazu bei, dass in der gegenseitigen Wahrnehmung Nuancen verschwinden und die jeweils Anderen v.a. als (oft mit negativen Vorurteilen behaftete) Vertreter ihrer ethnischen Gruppe gesehen werden. Aufgrund der fehlenden Unterstützung der aufnehmenden Gesellschaft für die Vervollständigung ihrer Integration und dem inzwischen erwachsenen Eindruck, diese wolle sie nicht als gleichberechtigte Bürger aufnehmen, ist Integration für Cem und Murat mittlerweile kein Thema mehr. Vermutlich sitzen die mit alltagsrassistischen Erfahrungen verbundenen Verletzungen so tief, dass es fraglich erscheint, ob sie sich als Folge positiver Erfahrungen überhaupt noch (wieder) als Teil der Mehrheitsgesellschaft fühlen könnten bzw. Anerkennung noch wahrnehmen würden und bereit wären, ihr Bild von �den Deutschen’ zu revidieren. Gleichzeitig lässt sich ihrer, wie einer der jungen Erwachsenen formuliert, „radikalen“ Reaktion entnehmen, dass ihr Wunsch nach Zugehörigkeit bzw. ihre Enttäuschung darüber, dass diese ihnen verwehrt wird, sehr groß ist. Zwar fühlen beide sie sich seit der Abkehr vom als Kinder und Jugendlichen empfundenen Assimilationsdruck eigenen Aussagen zufolge wohler und haben mit ihrer Zugehörigkeitsverortung eine individuelle Umgangsform mit einer gesellschaftlichen Problemlage gefunden. Doch konstatiert Murat: „Letztendlich ist es der falsche Weg, wenn man zusammen sein will. Also letztendlich hab ich mich dann wieder entfremdet“. Beide gehen jedoch davon aus, auch zukünftig weiter als �fremd’ definiert zu werden und insofern Integration als gleichberechtigte Gesellschaftsmitglieder nicht erreichen zu können. Aus diesem Grund sind sie im Alltag bemüht, Wut, Verletzungen und Gefühle von Machtlosigkeit, die sie mit dem Thema Integration und sonstigen Alltagsrassismen verbinden, zu verdrängen. Das gesamte Untersuchungssample betrachtend, fällt auf, dass die Befragten sich, obwohl sie mehrheitlich immer wieder mit Zurückweisungen konfrontiert werden, mehrheitlich bemüht sind, einen Platz in der �deutsche Gesellschaft’ zu finden. Dabei versuchen sie v.a. über strukturelle Erfolge in Schule und Beruf Anerkennung zu erlangen, ein Weg, der vielen infolge von Erfahrungen mit institutionellen Diskriminierungen erschwert wurde. Über die Integrationsstrategie einer verstärkten Etablierung in strukturellen Positionen hoffen sie, die ihnen zugewiesenen Handlungs- und Positionierungsoptionen erweitern und sich einen Platz im gesellschaftlichen Zentrum, an dem sie im Rahmen einer gleichrangigen Ausgangsposition zur Auflösung ethnischer Benachteiligungsstrukturen beitragen können, sichern zu können. Somit übernehmen sie Verantwortung für die Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse, um – so ihre Hoffnung – zukünftig „auf gleicher Augenhöhe“ mit Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft agieren zu können. Zudem sind viele auch über soziales bzw. politisches Engagement bemüht, ihnen wichtige gesellschaftliche Transformationen anzustoßen: Dabei versuchen sie z.B. durch Nachhilfeangebote zur Verbesserung der Bildungschancen von Kindern mit Migrationshintergrund beizutragen und durch Kritik sowie offensive Positionierungen existente ethnische Benachteiligungen zum Thema zu machen. Teilweise spielen sich ihre Bemühungen aber auch in deutlicher emotionaler Distanz zur Mehrheitsgesellschaft ab, so dass Integration verstärkt zu einem separiert statt miteinander gestalteten Prozess avanciert, nach dem Motto: �Wir schaffen es trotz und nicht mit Hilfe der deutschen Gesellschaft’. 3 SCHLUSSFOLGERUNGEN Die Ausführungen zeigen, dass Integration als gleichberechtigte Bürger mit der transnationalen Mehrfachzugehörigkeit für die jungen Erwachsen trotz ihrer Anstrengungen und ihrer differenten �Lösungsversuche’ (Assimilation, Bildungserfolge u.a.) ein unerreichbarer Zustand bleibt, solange vorherrschende Zuschreibungen und Ausgrenzungen ihnen die Möglichkeit entsprechender Positionierungen nicht ermöglichen. Alltagsrassismen in den verschiedenen Lebenskontexten, die – wie verschiedene AutorInnen konstatieren – ein präsenter Bestandteil im Alltag vieler Personen mit Migrationshintergrund bilden (vgl. u.a. Terkessidis 2004), erinnern sie immer wieder daran, dass sie vielfach weiter pauschal als �integrationsbedürftige Ausländer’ gesehen werden. Dies ist unabhängig davon, ob sie aufgrund der deutschen Staatsbürgerschaft rechtlich zur Gesellschaft gehören, perfekt Deutsch sprechen, Bildungserfolge erlangt haben, sich politisch engagieren, bemüht sind, wahrgenommene Assimilationsforderungen zu erfüllen oder sich zu beiden Zugehörigkeiten bekennen und demzufolge zumindest wissenschaftlichen Definitionen folgend integriert sind. Aus diesem Grund fühlen die jungen Erwachsenen sich trotz ihrer objektiven Integration nicht wirklich als Teil der Gesellschaft, in der sie schon so lange leben. Vor diesem Hintergrund heben sie wiederholt hervor, dass die Mehrheitsgesellschaft, die zumeist einseitig die defizitäre Integration von Eingewanderten hervorhebt oder davon spricht, dass diese sich integrieren sollen, indem sie Deutsch lernen, den Kern des Themas verfehlt. Solange rassistische Gesellschaftsstrukturen, Denk- und Handlungsmuster der aufnehmenden Gesellschaft sowie ihr Mitwirken an der Benachteiligung, Ausgrenzung und Negativ-Stereotypisierung von Eingewanderten kein Bestandteil öffentlicher Diskurse über Integration bilden und die scheinbar �selbstverständliche’, ethnisch differenzierte Gesellschaftsordnung nicht angetastet wird, bleiben zentrale Facetten des Integrationsthemas unberücksichtigt. Integration verlangt Anstrengungen von verschiedenen Seiten: Von den Eingewanderten ein Bemühen um den Erwerb der Landessprache, des relevanten gesellschaftlichen Orientierungswissens sowie um den Aufbau von Beziehungen zur aufnehmenden Gesellschaft und die Teilhabe an ihrem strukturellen System – Voraussetzungen, welche die interviewten jungen Erwachsenen schon lange erfüllen. Gleichzeitig hat eine Gesellschaft die Aufgabe, Personen mit Migrationshintergrund eine Integration als dauerhaft zugehörige Gesellschaftsmitglieder zu ermöglichen. Dies setzt u.a. die offizielle Anerkennung durch höher positionierte gesellschaftliche Ebenen voraus, dass alltagsrassistische Erfahrungen für viele Eingewanderte ein Problem und keine Ausnahmeerscheinung darstellen und insofern diskutiert werden müssen. Auch erfordert dieser Schritt die Bereitschaft, etablierte Vorstellungen von (Nicht-) Zugehörigkeiten zu überdenken, sowie ein Bemühen um die Beseitigung von strukturellen und institutionellen Ausgrenzungen. Wenig Anlass zu Optimismus geben existente Benachteiligungen Eingewanderter im Bildungsbereich oder auf dem Arbeits- oder Wohnungsmarkt. Auch der aktuell wieder verstärkte Negativfokus öffentlicher Diskurse über die Integration von Personen mit Migrationshintergrund (v.a. muslimischer Zugehörigkeit) bzw. über deren angebliches Scheitern wirkt verstärkend auf gesellschaftliche Polarisierungen entlang ethnischer Herkünfte. Hinzu kommt, dass in mehreren aktuellen Untersuchungen eine weite Verbreitung alltagsrassistischer Denkmuster innerhalb der Mehrheitsgesellschaft bzw. deren Zunahme in den letzten Jahren konstatiert wird (vgl. z.B. Heitmeyer 2005). Diese Phänomene könnten zu einer Verschärfung der beschriebenen Abgrenzungstendenzen beitragen und Anfälligkeiten für extreme Orientierungen hervorrufen. Nicht nur vor dem Hintergrund dieser Gedanken macht der wachsende Anteil von Personen in unserer Gesellschaft, dem die selbstverständliche Zugehörigkeit verweigert wird, auf die Dringlichkeit der Dekonstruktion einer von Alltagsrassismen geprägten Wirklichkeit und die Etablierung der Zugehörigkeit Eingewanderter als fraglos gegebene Selbstverständlichkeit aufmerksam. Dies bildet die Grundlage dafür, damit Positionierungen außerhalb der Gesellschaft verhindert und Integration ohne Vorbehalt stattfinden kann. “ Dr. Barbara Schramkowski Die Studie ist als Buch erschienen und mit folgenden bibliographischen Angaben über den Buchhandel zu beziehen: Schramkowski, Barbara (2007): Integration unter Vorbehalt. Perspektiven junger Erwachsener mit Migrationshintergrund. Frankfurt a.M./ London: IKO-Verlag, Preis € 26,90 (406 S.) / ISBN 3-88939-836-7
http://www.idw-online.de
Quelle: Informationsdienst Wissenschaft Dr. Barbara Schramkowski