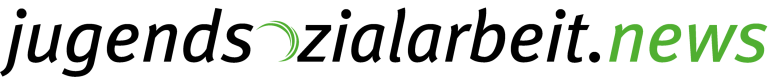DAS ERLEBNIS DER PRODUKTION Ausgehend von der Fachtagung ‚Produktionsorientiertes Lernen für benachteiligte Jugendliche‘ im Rahmen der Transferphase des BQF-Programms möchten wir die Thematik Produktionsschulen und deren Förderansätze für benachteiligte junge Menschen noch mal aufgreifen. Lesen Sie hierzu den anschließenden Aufsatz von Günther Schaub (Deutsches Jugendinstitut). Der Hauptvortrag der Fachtagung (BQF-Transfer) vom 18. Juni 2007 ist für Sie im Anhang bereit gestellt. Die Dokumentation der Tagung ist in Kürze der Homepage www.kompetenzen-foerdern.de zu entnehmen. “ Wesentliche Elemente und Ziele der Produktionsschule finden sich bereits in den etwa 1000 so genannten Schülerwerkstätten, die der Deutsche Verein für Knabenhandarbeit in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts initiierte. Sie trugen dem Umstand Rechnung, dass die wachsende Industrie nach handwerklich gut ausgebildeten Arbeitskräften mit hoher Arbeitsmoral verlangte. Die „Knabenhandfertigkeitsbewegung“ konnte sich jedoch nicht im beginnenden allgemeinen Schulwesen etablieren, das einen nach wissenschaftlichen Kriterien organisierten Unterricht auf der Basis eines theoretischen Konzepts, einer systematischen Theorie des Lernens und Lehrens und eines pädagogischen Lehrplans favorisierte. Die Ideen hielten sich jedoch. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts prägte der Münchner Stadtschulrat Georg Kerschensteiner den Begriff der Arbeitsschule als Gegenentwurf zur herkömmlichen, inzwischen etablierten Lernschule („Buchschule“). Später hat sich im Anschluss an die Reichsschulkonferenz 1920 im Umfeld der Reformpädagogen („Bund der entschiedenen Schulreformer“) in den 20er Jahre der Begriff Produktionsschule durchgesetzt (Oestreich 1924). In der Folge gab es immer wieder meist lokal und regional begrenzte Versuche, die Ideen der Schulreformer umzusetzen, etwa in den so genannten Gartenarbeitsschulen in Berlin-Neukölln (Henning 1993). Das Vorbild Das Vorbild für die deutschen Produktionsschulen sind die über 100 dänischen Produktionsschulen, die ein Ergebnis der dänischen Volksbildungsbewegung sind, die bis in das 18. Jahrhundert zurückreicht. Heute sind sie eine anerkannte selbstständige Schulform auf gesetzlicher Basis, die für alle Produktionsschulen einheitliche Rahmenbedingungen hinsichtlich Zweck, Tätigkeit, Zielgruppe, Aufenthaltsdauer usw. festlegt. Zentrales Merkmal der dänischen Produktionsschulen ist die gesicherte Regelfinanzierung durch Staat und Kommunen. Es war und ist erklärtes Ziel der dänischen Regierung, dass alle Jugendlichen eine allgemeine Ausbildung oder eine gewerbliche Grundausbildung bzw. eine Jugendausbildung absolvieren. Alle jugendlichen Arbeitslosen, die Arbeitslosen- oder Sozialhilfe beziehen, sind verpflichtet, spätestens nach drei Monaten ein Aktivierungsangebot anzunehmen. Dies kann entweder eine Ausbildung, eine Beschäftigung oder eben der Besuch einer Produktionsschule sein. Sie stellen ein Angebot für einheitliche Lern- und Produktionsprogramme für Jugendliche unter 25 Jahren dar, die bisher keine Jugendfortbildung beendet haben. Im Wesentlichen handelt es sich um Schul-, Berufsschul- und Gymnasialabbrecher. Das Angebot einer dänischen Produktionsschule umfasst praxisbezogene Arbeit, Herstellung von Produkten und theoretischen Unterricht. Obligatorische Fächer sind Mathematik und Informatik, weitere Kurse werden individuell gewählt. Die Produktionsschule ist ein Ganztagsangebot mit mindestens 30 Stunden wöchentlich. Die Aufenthaltsdauer beträgt maximal ein Jahr und im Durchschnitt 21 Wochen. Die Vergütung für Jugendliche unter 18 Jahren beträgt 286 Euro, für Jugendliche über 18 Jahren 693 Euro pro Monat. Innerhalb dieses allgemeinen Rahmens hat jede Schule einen weitgehenden Spielraum, eigene Ziele und Tätigkeit auszulegen und zu verwirklichen, so wie sie es (ausgehend von den örtlichen Bedingungen) für angemessen hält. In Dänemark kann die Gründung einer Produktionsschule sowohl von einer Kommune als auch von mehreren Kommunen oder von einem Kreis ausgehen. Dabei sind die Initiatoren gleichzeitig die genehmigende Behörde, welche die Vorschriften festlegt. Aufgabe der Kommune ist es, für die Bereitstellung von Startkapital, Räumen und Ausrüstung zu sorgen. Ferner ist sie dafür verantwortlich – ungeachtet der Anzahl von Plätzen – den Produktionsschulen einen jährlichen Grundzuschuss zu bewilligen, der 2005 zirka 51.130 Euro pro Jahr betrug. Die Pädagogik Die Produktionsschulen sind Einrichtungen für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf, in denen Arbeiten und Lernen miteinander kombiniert werden. Ihr Markenzeichen ist das Lernen im marktnahen Produktions- und Arbeitsprozess. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben Unterricht in allgemeinbildenden Kernfächern und können auf unterschiedlichen Niveaus berufliche Orientierung und Qualifizierung erwerben. Ziele der Produktionsschulen sind darüber hinaus die Stabilisierung und Entwicklung der Persönlichkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die Herstellung von marktfähigen Produkten und Dienstleistungen, denn das Schaffen von Werten stabilisiert das Selbstwertgefühl, das die Basis für eine gefestigte Persönlichkeit bildet. Die Jugendlichen sollen durch die eigene Arbeit und durch selbstständiges Handeln lernen. Folglich zentriert sich der Unterricht um die Werkstätten, wo den Jugendlichen eine breite Auswahl realer Projekte und Herstellungsverfahren zur Verfügung steht. Jedes Produkt wird im Hinblick auf den Verkauf hergestellt. Die Qualität der Erzeugnisse muss sich an den Anforderungen des Marktes orientieren. Die dänischen Produktionsschulen können die eigene Produktion unter Bedingungen vertreiben, die aus der Sicht der privaten Unternehmen „keine unbillige Konkurrenz“ darstellen. Die Verkaufserlöse aus den Dienstleistungen und der Produkte gehen in den Jahresabschluss der Schule als Ertrag ein. Dänemark hatte Mitte der 80er Jahre eine hohe Jugendarbeitslosigkeit zu verzeichnen. Mit dem Konzept der Produktionsschulen konnte der Anteil der Jugendlichen, die keine Ausbildung erhalten, von 1990 bis 2000 von 18 auf 13 Prozent gesenkt werden. Die Hälfte der Schülerinnen und Schüler nahm nach Verlassen der Produktionsschule eine staatlich anerkannte Ausbildung auf, jeder vierte ging direkt in den Arbeitsmarkt. Der Erfolg des dänischen Produktionsschulmodells ist eng verbunden mit dem Produktionsschulgesetz, der gesicherten Finanzierung, der einheitlichen Regelung und der gesellschaftlichen Akzeptanz der Bildung Benachteiligter. Produktionsschulen und -ansätze in Deutschland In den 90er Jahren hat man in Deutschland die Produktionsschule als ein „altes Konzept für aktuelle Probleme“ (Biermann 1994) neu entdeckt. Zu unterscheiden ist allerdings zwischen Produktionsschulen im engeren Sinn, die sich an das dänische Vorbild anlehnen, und Schulen und anderen (Aus-)Bildungseinrichtungen, die Elemente und Ziele des Produktionsschulansatzes (insbesondere die Realitäts- und Marktnähe der Ausbildung) übernehmen. In Deutschland gibt es gegenwärtig etwa 20 Produktionsschulen bzw. Einrichtungen mit produktionsschulorientiertem Ansatz. Sie konzentrieren sich auf das Bundesland Hessen, weil dort die Programme EIBE und START zur Finanzierung von Produktionsschulen genutzt werden können. Außerdem scheint die hessische Landesregierung dem Ansatz der Produktionsschule besonders aufgeschlossen gegenüber zu sein. Ähnliches gilt für Mecklenburg-Vorpommern. Zielgruppen der deutschen Produktionsschulen im engeren Sinn sind nach dänischem Vorbild schulmüde Jugendliche, Schulabbrecher, Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Ausbildungsabbrecher und arbeitslose Jugendliche. Der Arbeitsverbund Produktionsschule Nord (AVPN) hat im Juli 2006 Produktionsschulprinzipien erarbeitet. Danach versteht sich die Produktionsschule als Bildungs-, Arbeits- und Lebensort, an dem Jugendliche neue Erfahrungen machen können und der ihnen Übergänge zu Bildung und Beruf ermöglicht. An der Produktionsschule bedingen sich Arbeit (im realen Produktionsprozess) und Lernen (in Form von Unterricht) gegenseitig. Vorrangige Zielgruppe sind Jugendliche im Alter von 15 bis 25 Jahren ohne oder mit unzureichendem Schulabschluss und/oder ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Eine Produktionsschule produziert für den Verkauf oder bietet Dienstleistungen an, die auf dem Markt realisiert werden. Lernprozesse finden mittels realer Produktionsprozesse statt. Produktionsschulen können Teilqualifizierungen sowie schulische Abschlüsse und/oder die Vorbereitung auf einen staatlich anerkannten Schulabschluss anbieten. Die Teilqualifikationen müssen allerdings als Teile („Module“) der Inhalte anerkannter Ausbildungsberufe definiert sein, wenn sie von Unternehmen nachgefragt und somit arbeitsmarktfähig sein wollen. Insofern ist die Kooperation mit den zuständigen Kammern unerlässlich. Die Kammern können Teilqualifikationen jedoch nur anerkennen, wenn sie auch an der Leistungsfeststellung beteiligt werden (Marschelke 2002). Wenngleich die deutschen Produktionsschulen, die häufig mit Berufsschulen kooperieren, ihre Aufgaben, Zielgruppen und Ziele unterschiedlich definieren, verweisen doch ihre Leitsätze auf das dänische Vorbild: „Praxisnahe Berufsorientierung, verbunden mit realer Berufswegefindung“ (Produktionsschule Moritzburg gGmbH) „praktisches und theoretisches Lernen durch die Produktion von Waren und Dienstleistungen“ (Produktionsschule Altona) „Steigerung des Selbstvertrauens und der Leistungsbereitschaft Jugendlicher durch die Herstellung sinnvoller, von der Gesellschaft benötigter Produkte“ (Produktionsschule Neumühle) „Lernen und Qualifizieren im Produktionsprozess“ (Produktionsschule A2 Minden) „Förderung der Lernmotivation und Steigerung des Selbstwertgefühls durch nützliche und gesellschaftlich anerkannte, produktive Tätigkeiten“ (Produktionsschule Offenbach). Die dänischen Produktionsschulen unterscheiden sich von den deutschen vor allem durch die gesetzliche Grundlage, die gesicherte Regelfinanzierung und die einheitlichen Rahmenbedingungen. In Deutschland dagegen basiert die gesamte Berufsausbildungsvorbereitung auf verschiedenen gesetzlichen Grundlagen. Gleiches gilt für die berufliche Benachteiligtenförderung. Die (wenigen) deutschen Produktionsschulen arbeiten in unterschiedlichen Trägerschaften und Rechtsformen und werden aus verschiedenen Töpfen (ESF, Bund, Länder, Kommunen, Landkreise, Agentur für Arbeit, Jobcenter, Stiftungen, Spenden u. a.) finanziert. Ihre Existenz ist daher in aller Regel nicht langfristig gesichert. Vor allem Projekten, die überwiegend oder ausschließlich im Rahmen von Modellprogrammen (EIBE, START, BQF etc.) finanziert werden, droht mit dem Ende der Modellförderung das Aus. Sie sind auf Folgeprogramme angewiesen oder darauf, dass die zuständigen Landesministerien gegenüber dem Ansatz der Produktionsschulen aufgeschlossen sind und die Anschlussfinanzierung übernehmen. Das scheint jedoch eher selten der Fall zu sein. Von den im Rahmen des BQF-Programms vom BMBF geförderten Produktionsschulen beispielsweise haben mindestens zwei (Schule produziert – Produktion schult und Werk-Statt Schule) nach dem Auslaufen des Programms BQF ihre Arbeit eingestellt. Die ebenfalls zunächst aus BQF-Mitteln geförderte Produktionsschule BOSS in Waren (Müritz) dagegen wird aus Landesmitteln weiter gefördert. Da Zielgruppen, Rahmenbedingungen etc. der Produktionsschulen in Deutschland notgedrungen den unterschiedlichen Förder- und Finanzierungsmodalitäten folgen müssen, sind einheitliche Standards schwer durchzusetzen. Eine inzwischen gegründete Bundesarbeitsgemeinschaft hat zwar Richtlinien verabschiedet, die jedoch nicht zwingend sind. Wird beispielsweise ein Programm für schulmüde Jugendliche aufgelegt, muss eine Produktionsschule diese Zielgruppe aufnehmen, wenn sie in den Genuss der Förderung kommen will. Das bedingt unter Umständen Änderungen in der Konzeption und Ausrichtung. Umgekehrt muss sich eine Produktionsschule auf nicht mehr berufsschulpflichtige junge Erwachsene konzentrieren, wenn die Fördermodalitäten das so vorsehen. Die Produktionsschule ist dann eher ein Jugendhilfebetrieb. Ein weiteres Problem: Mit zunehmender Marktfähigkeit, die per Definition auch Konkurrenzfähigkeit impliziert, können die gemeinnützigen Träger von Produktionsschulen und Jugendhilfebetrieben mit ihrem marktorientierten Ansatz in Konkurrenz zu „regulären” Wirtschaftsbetrieben geraten, die in der Subventionierung solcher Projekte eine Wettbewerbsverzerrung sehen. So hat beispielsweise ein Projekt, das sich auf den Entwurf und Bau von Spielplätzen im Auftrag von Kommunen spezialisiert hat, massive Probleme mit dem Garten- und Landschaftsbauverband (GaLa) bekommen, in dem die in dieser Branche aktiven Betriebe – also auch Betriebe, die im Spielplatzbau arbeiten – organisiert sind. In einem vom GaLa gegen eine Kommune geführten Verwaltungsgerichtsverfahren wurde zwar das Recht der Kommunen bestätigt, in freier Vergabe sozial gebundene Aufträge an Beschäftigungsfirmen zu erteilen. Ein Antrag des Projekts auf Aufnahme in den Garten- und Landschaftsbauverband wurde jedoch aus formalen Gründen abgewiesen. Am Beispiel dieser Spielplatzbauer offenbart sich denn auch das Dilemma eines öffentlich subventionierten zweiten Ausbildungs- und Arbeitsmarktes, dem einerseits realitätsferne bloße Beschäftigungstherapie vorgeworfen, andererseits Wirtschaftlichkeit und Marktfähigkeit untersagt wird. Ein Prinzip macht Schule Da der Begriff Produktionsschule nicht geschützt ist, versammeln sich in Deutschland inzwischen unter dieser Bezeichnung Schulen und schulähnliche Einrichtungen aller Art für die verschiedensten Zielgruppen: schulpflichtige schulmüde Jugendliche und Schulabbrecher, berufsschulpflichtige Jugendliche ebenso wie arbeitslose junge Erwachsene ohne abgeschlossene Berufsausbildung jenseits der Berufsschulpflicht. Niemand kann etwa einer Berufsschule, deren BVJ-Schülerinnen und -Schüler gelegentlich Pappkartons herstellen, verbieten, sich Produktionsschule zu nennen. Ebenso sind neben dem Begriff Produktionsschule die verschiedensten oft synonym gebrauchten Bezeichnungen im Umlauf: Schülerfirma, Juniorfirma, AzubiFirma, Übungsfirma, Jugendhilfebetrieb, Beschäftigungsfirma. Es gibt inzwischen viele schulische und außerschulische Lernorte, die die Elemente und Ziele des Produktionsschulansatzes übernommen haben. Besonders ein zentrales Grundprinzip der Produktionsschule – Lernen im marktorientierten Arbeitsprozess – hat sich inzwischen in Deutschland auf allen Ebenen durchgesetzt. An vielen allgemeinbildenden und beruflichen Schulen jedweder Art gibt es inzwischen Schüler- oder Juniorfirmen in Form von Arbeitsgemeinschaften, eingetragenen Vereinen, Genossenschaften, GbR bis hin zur gGmbH und GmbH. Es handelt sich zwar überwiegend um Einzelinitiativen engagierter Lehrkräfte und Schulleiter, die allerdings in vielen Bundesländern durch die Kultusministerien und von Wirtschaftsverbänden unterstützt und gefördert werden. Überall geht es darum, den Ernst des Lebens (oder besser: der Arbeit) einzuüben. Das Prinzip des Lernens im marktorientierten Arbeitsprozess wird dadurch allen (und nicht nur den benachteiligten) Jugendlichen an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen zugänglich gemacht. So unterhält bei¬spielsweise in München unter der Regie des Schulreferats nicht nur die städtische Schule zur Berufsvorbereitung eine Produktionsschule (mit Partyservice, Fahrradwerkstatt und Produkten wie Holzarbeiten, Metallwaren, Polsterarbeiten) als besondere Form des Berufsvorbereitungsjahres, sondern auch die Berufsschule für den Einzelhandel und die Berufsschule für elektrische Anlagen- und Gebäudetechnik (Herstellung und Verkauf von Elektrowaren und Metallarbeiten wie Lampen, Uhren, Gürtel), die Fachakademie für Hauswirtschaft (Partyservice), das Fremdspracheninstitut der Landeshauptstadt München (Übersetzungen, Vermittlung von Dolmetschern) und die Städtische Berufsschule für Holztechnik und Innenausbau (Produkte aus Holz wie Wanduhr und Brotzeitbrett). Eigentlich handelt es sich dabei aber um Schülerfirmen, die sich häufig auch Juniorfirma nennen. Juniorfirmen (häufig auch noch Übungsfirmen genannt) wiederum werden nicht nur (wie beispielsweise vom IB in Stuttgart unter dem Namen modiko oder von der Initiative Jugendarbeitslosigkeit Neuruppin e. V. in einem Übungsrestaurant und -hotel) im Rahmen der außerbetrieblichen Ausbildung von Bildungsträgern unterhalten, um die Ausbildung realitäts- und marktnäher zu gestalten, sondern auch von renommierten Unternehmen im Rahmen der regulären Ausbildung. Die Daimler-Chrysler AG in Sindelfingen beispielsweise unterhält mit der A-Tec eine Juniorfirma, die von Auszubildenden geführt wird und als Dienstleistung Reparaturen von privaten Fahrzeugen anbietet. Auf diese Weise wird ein neues Lernfeld geschaffen, in dem die Auszubildenden durch reale Aufträge und „learning by doing“ die betriebswirtschaftlichen Abläufe eines Unternehmens kennenlernen. Die Auszubildenden lernen, selbstständig zu handeln, Entscheidungen zu treffen und auch die Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Des Weiteren wird durch die enge Zusammenarbeit der kaufmännischen und technischen Auszubildenden das Verständnis für die Aufgabenstellungen der jeweiligen Berufsgruppen verbessert. Durch den Einsatz in der AzubiFirma A-Tec werden die Fachkompetenz gestärkt und Schlüsselqualifikationen, wie die Kooperations- oder Kommunikationsfähigkeit z. B. im Umgang mit Kunden, gefördert. Der Ausbilder nimmt dabei die Funktion des Beraters ein. Ähnliche Konzepte verfolgen beispielsweise BMW, VW, Carl Zeiss, Juventus und viele andere Firmen, aber auch Kommunen und kommunale Verkehrsbetriebe und Stadtwerke. Auch der klassische Jugendhilfebetrieb firmiert heute häufig unter der etwas flotteren Bezeichnung Produktionsschule. Ihrem eigenen Selbstverständnis nach sind auch sie marktorientierte Produktionsbetriebe. Die Beschäftigtenstruktur deutet allerdings in der Regel in Richtung Qualifizierungs- und Maßnahmebetrieb. Der Kostendeckungsanteil aus betrieblichen Leistungen übersteigt selten die Zehn-Prozent-Marke und erreicht nur in Ausnahmefällen (wie etwa bei den oben beschriebenen Spielplatzbauern) 50 Prozent und mehr. Fazit Die Produktionsschule nach dänischem Vorbild ist als ergänzendes und flächendeckendes Angebot des deutschen Bildungssystems speziell für benachteiligte Jugendliche ohne gesicherte rechtliche und finanzielle Grundlage nicht durchsetzbar. Eine Forderung lautet daher, die Qualifizierung in einer Produktionsschule, die mit anerkannten Abschlüssen endet, in die Regelförderung des SGB II und III zu übernehmen (Bündnis 90/Die Grünen 2006). Das scheint allerdings derzeit wenig wahrscheinlich. Allenfalls könnte die Produktionsschule in einigen Bundesländern, die sich diesem Ansatz gegenüber offen zeigen, als ein solches zusätzliches Angebot punktuell eingerichtet werden. Diskutiert wird auch über so genannte „Produktionsschul- Modellregionen“ (Schulte 2006). Auch wenn sich Produktionsschulen als „eigenständiger Bestandteil des beruflichen Bildungssystems“ verstehen (AVPN), spricht doch vieles dafür, dass sie bis auf Weiteres ihren modellartigen Charakter behalten werden. Bemerkenswert ist jedoch vor allem, dass wesentliche Elemente des Produktionsschulansatzes in vielfältiger Form und unterschiedlicher Intensität in das deutsche Bildungs- und Ausbildungssystem Einzug gehalten haben. Das Prinzip des Lernens im Arbeits- und Produktionsprozess nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zum theoretischen Lernen stellt den Bezug her zum realen Marktgeschehen. Somit wurden und werden die Ideen der „entschiedenen Schulreformer“ um Paul Oestreich die reine „Lernschule“ um produktionsorientierte Ansätze erweitert. “
http://www.dji.de
http://www.gib.nrw.de
http://www.kompetenzen-foerdern.de/2563.php
Quelle: DJI, G.I.B. Info 4/2007
Dokumente: Braun_Lex_Vortrag.pdf